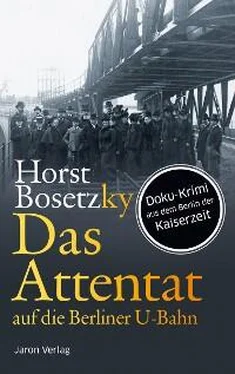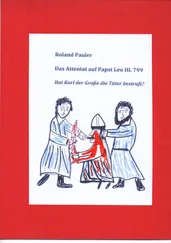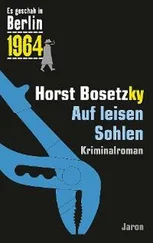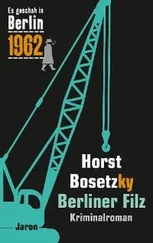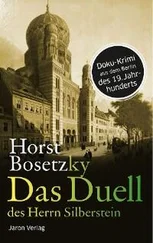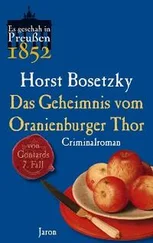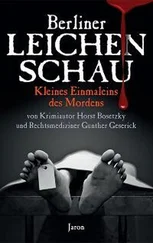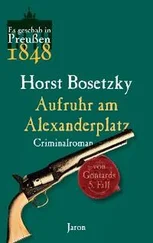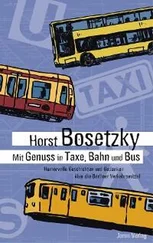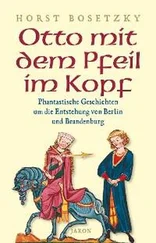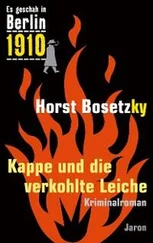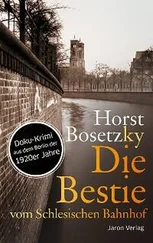Nach Preußen zurückgekehrt, schloss er sich der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei an, die 1869 in Eisenach unter der Führung von August Bebel und Wilhelm Liebknecht gegründet worden war. Lange Zeit machte man Front gegen Ferdinand Lassalles Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, stimmte aber im Mai 1875 in Gotha doch für die Vereinigung beider Parteien zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Theodor Blumenthal brachte es aufgrund seiner organisatorischen Fähigkeiten und seiner rhetorischen Begabung bald zum Funktionär und Abgeordneten. Am 19. Oktober 1878 aber billigte der Reichstag mit 221 gegen 149 Stimmen das von Kaiser Wilhelm I. erlassene »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie«. Jeder, der verdächtigt wurde, mit den Sozialdemokraten zu sympathisieren, konnte verfolgt und verhaftet werden. Die neun sozialdemokratischen Abgeordneten durften zwar ihr Reichstagsmandat weiterhin ausüben, der Partei waren jedoch alle Versammlungen verboten.
Theodor Blumenthal war heute so fröhlich, dass sein Bruder aus dem Staunen gar nicht mehr herauskam.
»Du, du wirst lachen, aber die Arbeit im Untergrund macht Spaß. Hier, lies das mal!« Er schob Berthold einen engbeschriebenen Bogen hinüber.
»Was ist denn das?«
»Ein Polizeibericht.«
»Wie kommst du denn an den?«
»Man hat so seine Beziehungen.«
Berthold Blumenthal überflog den Text.
Was die Organisation der Sozialisten anbelangt, so werden hier täglich an den verschiedensten Orten, in Privatwohnungen, Werkstätten, auf Spaziergängen, in Schanklokalen, oft sogar in dunklen Räumen, kleine Zusammenkünfte von sechs bis sieben Personen abgehalten, bei denen Mitteilungen und Anweisungen von den bald hier, bald dort erscheinenden Führern gemacht resp. erteilt werden. Man errichtet Lesezirkel, Gesangsvereine, arrangiert Tanzkränzchen. Alles zu dem Zweck, um unter der harmlosen Maske einer geselligen Unterhaltung ernste Beratungen über Parteiangelegenheiten pflegen zu können.
»Wie findest du das?«, fragte Theodor Blumenthal.
»Bebel hat recht, das Sozialistengesetz wird euch entscheidend stärken.«
Die illegal gewordene Partei hatte sich schnell den neuen Bedingungen angepasst. Die Organisationspyramide war nur unsichtbar geworden, es gab sie aber dennoch. Man traf sich zumeist in den Hinterzimmern von Gaststätten, deren Wirte als zuverlässig galten.
»Das läuft alles bestens«, erklärte Theodor Blumenthal. »Schwierigkeiten haben wir nur, wenn eine Vollversammlung der Vertrauensleute ansteht, eine Corpora, wie wir das nennen, denn das sind zu viele Leute für ein Kaffeekränzchen oder eine Billardrunde.«
Ihr Dialog wurde abrupt unterbrochen, als im Wohnzimmer der Gong geschlagen wurde. Sie sprangen auf, denn Magdalena ließ nicht mit sich spaßen, wenn jemand zu spät zu einer Mahlzeit kam. Die drei Knaben saßen bereits ordentlich aufgereiht am Tisch, während die Köchin dabei war, die Suppe aus der Terrine zu schöpfen und auf die Teller zu verteilen. Das Baby lag in seinem Bettchen und schlief.
Magdalena sprach das Tischgebet, dann konnte munter drauflosgeplaudert werden, obwohl wegen der Kinder bestimmte Themen ausgeschlossen waren, etwa die Verhaftung einiger »lüderlicher Dirnen«, die bei der Ausübung ihres Gewerbes ihre Freier bestohlen hatten.
Theodor, der unverehelicht war, berichtete vom Schaufrisieren der Berliner Friseur- und Barbierinnung im Buggenhagener Kaisersaal. »So manche Barbierstube dient der Partei als geheimer Treffpunkt, und so ist es kein Wunder, dass ich eingeladen worden bin. Was mich aber am meisten begeistert hat, waren nicht die preisgekrönten Frisuren der Damen, sondern die Büste des Kaisers: Die war nämlich aus Seife geformt. Ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass … Aber lassen wir das!« Mit Blick auf die Knaben und seine Schwägerin verbot er sich, seiner Phantasie freien Lauf zu lassen.
Magdalena Blumenthal stieß dennoch ein warnendes Hüsteln hervor und zitierte aus dem Brief des Paulus an die Römer den Anfang des 13. Kapitels: »Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen.«
Theodor Blumenthal nickte. »Sicher, denn die herrschenden Werte sind immer die Werte der Herrschenden, da muss ich Karl Marx recht geben, und da die herrschende Klasse immer auch für die Götter zuständig ist, wird sie die von ihr erdachten Götter auch in ihrem Sinne handeln lassen.«
»Lieber Schwager, ich möchte dich doch ernsthaft bitten, die Harmonie unseres Gastgebots nicht in Gefahr zu bringen. Du weißt ja, ich sehe die Stachelschrift nicht gern in meinem Hause.«
»Bitte, Magdalena …«
»Nein, schweige bitte, wer politisiert, ist nur allzu leicht ein Haberecht. Und du verböserst die Sache nur noch.« Sie sah ihren Ältesten an. »Benedikt, erfreue du uns lieber mit den neuesten Hervorbringungen der Herzenszähmerin.«
»Mutter, darf ich vorher noch aufstehen und hofieren?«, fragte Benjamin, der dem Alter nach hinter Benedikt kam.
Theodor Blumenthal musste sich sehr beherrschen, nicht loszuprusten, glaubte er doch, aus den Worten seines Neffen einen leichten Spott an der altertümelnden Sprache seiner Mutter herauszuhören. Doch der Junge schien es ernst zu meinen und eilte, als er die Erlaubnis dazu bekam, auf die Toilette.
Magdalena Blumenthal gehörte einem Verein an, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, dem Tod altdeutscher Wörter entgegenzutreten. Wörter wurden geboren, Wörter welkten dahin und starben – das aber wollten sie und ihre Mitstreiter verhindern. Das Gastgebot war ein feierlicher Schmaus, den man den Gästen bot. Ein Haberecht war ein Rechthaber und die Herzenszähmerin die Dichtkunst. Hofieren war deckungsgleich mit dem lateinischen Wort cacare und meinte: seine Notdurft verrichten.
»Gut, dass der Junge sich rechtzeitig gemeldet hat«, sagte Theodor Blumenthal, »denn Harnverhaltung ist eine schlimme Sache, der große Tycho Brahe ist sogar daran gestorben. Vielleicht wird Benjamin ja mal Harnprophet.« Das hatte er so ernsthaft gesagt, dass seine Schwägerin nicht verstimmt sein konnte. Er wusste, dass Harnprophet eigentlich ein Spottname für die Ärzte der alten Schule war, die angaben, in den meisten Fällen Krankheiten aus der Beschaffenheit des Harns erkennen zu können.
Berthold Blumenthal hatte das Geplänkel zwischen seinem Bruder und Magdalena ziemlich genossen, fürchtete aber, dass seine Frau langsam doch zornig werden würde, und ergriff daher selber das Wort, um das Gespräch auf Themen zu lenken, die weniger verfänglich waren.
»Weil wir uns in der Kanzlei immer wegen der Rechtschreibung streiten, habe ich mir bei meinem Buchhändler das Vollständige Orthographische Wörterbuch der deutschen Sprache von Konrad Duden bestellt.«
»Ja, ich habe mich gerade mit meinem Chefredakteur gestritten, ob man nun Satire oder Satyre schreibt«, fügte Theodor Blumenthal hinzu.
»Der Deutsche schreibt am besten Stachelschrift«, merkte Magdalena Blumenthal an.
»Diesmal muss ich dir recht geben, liebe Schwägerin. Das mit den Stacheln ist nicht schlecht, und wenn ich einmal eine Satire-Zeitschrift gründe, dann nenne ich sie Stachelschwein .«
In diesem Augenblick kam die Köchin herein und hielt einen Gegenstand in der Hand, von dem sie offensichtlich annahm, dass er jeden Augenblick explodieren könne. »Wat solln die hier: ’ne Kartätsche bei mir inne Küche? Wer hat ’n die einjeschleppt?«
»Ich, werte Dame.« Theodor Blumenthal deutete eine leichte Verbeugung an. »Für die gnädige Frau. Statt Blumen.«
Читать дальше