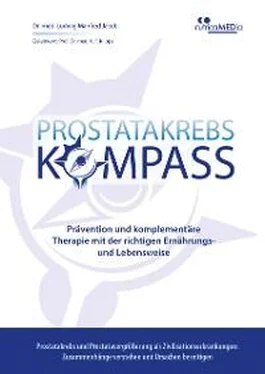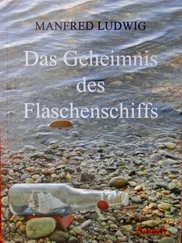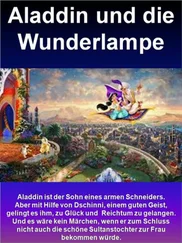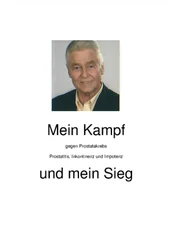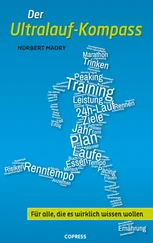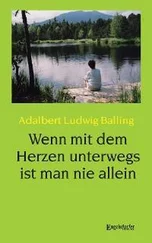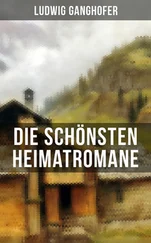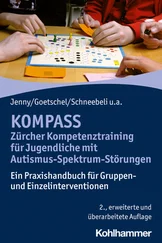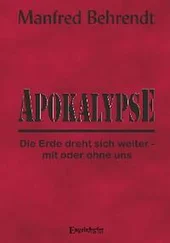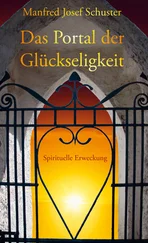Insulinresistenz, Hyperinsulinämie und eine Ernährung, die reich an tierischem Protein und einfachen Kohlenhydraten wie Zucker oder Weißmehl ist, fördern die Produktion von IGF-1 in der Leber, das als Wachstumsfaktor zur Entstehung eines PCa beiträgt. Entsprechend gehen erhöhte IGF-1-Werte im Blut mit einem erhöhten PCa-Risiko einher (Price et al. , 2012). Dies wird noch ausführlich im Kapitel 3.6(Seite 43) und 6.3(Seite 170) erörtert.
Adipositas ist ein starker Risikofaktor für aggressiven Prostatakrebs (MacInnis et al. , 2003; Gong et al. , 2006). In der Cancer Prevention Study II mit fast 70.000 Männern ging ein hoher Body Mass Index (BMI) mit einem erhöhten Prostatakrebsrisiko im 11-jährigen Follow-Up-Zeitraum der Studie einher. Adipöse Männer mit BMI < 30 hatten ein 1,54-faches Risiko für einen aggressiven Prostatakrebs im Gegensatz zu Männern mit BMI < 25 (Rodriguez et al. , 2007). Dies ist u. a. auf Änderungen der Östrogen-, Testosteron- und Insulinspiegel sowie auf die insgesamt proentzündliche Stoffwechsellage bei Übergewicht zurückzuführen.
Übergewicht fördert vor allem die Progression zu bösartigen Tumoren: Während das Risiko für niedriggradigen Prostatakrebs mit höherem BMI leicht sank, erhöhte sich das Risiko für höhergradigen, aggressiven und tödlich verlaufenden Prostatakrebs deutlich (Rodriguez et al. , 2007). Männer, die innerhalb der 10 Jahre vor Beginn der Studie mehr als 5 kg Gewicht verloren hatten, konnten dagegen ihr Risiko, an einem höhergradigen, aggressiven Prostatakrebs zu erkranken, um 42 % senken.
In der Studie von Roehrborn et al. (2006) mit 4820 Männern wurde ein Zusammenhang zwischen einem hohen BMI und dem Prostatavolumen, dem Volumen der Übergangszone und der Ausprägung eines LUTS festgestellt.
Das metabolische Syndrom wird auch mit schnell wachsender BPH in Zusammenhang gebracht, welches ein weit stärkerer Risikofaktor für PCa sein kann als eine langsam wachsende BPH (Hammarsten und Högstedt, 1999 und 2002; Ozden et al. , 2007).
2.5.3 Prostatavergrößerung als Vorstufe von Prostatakrebs?
Epidemiologische Zusammenhänge zwischen BPH und PCa sind schon lange bekannt, doch auch anatomische, pathologische und genetische Zusammenhänge werden immer stärker sichtbar (Alcaraz et al. , 2009). BPH und PCa weisen Ähnlichkeiten auf und existieren häufig gleichzeitig. Bei der Entstehung beider Erkrankungen spielen Androgene und Östrogene eine bedeutende Rolle. Und in beiden Fällen wird die Evidenz für die Bedeutung von Entzündungsprozessen stärker, wenn auch bisher noch kein kausaler Zusammenhang eindeutig nachgewiesen werden konnte (Bostwick et al. , 2004).
BPH wird zwar nicht offiziell als Vorläufer von PCa eingestuft, doch vielen Prostatakarzinomen geht eine BPH voraus (Alcaraz et al. , 2009). Autopsiestudien zeigen, dass die meisten Prostatatumoren (83 %) sich bei Männern entwickeln, die eine BPH haben, unabhängig vom Alter des Patienten (Bostwick et al. , 1992). Insbesondere eine schnell wachsende BPH geht mit einem erhöhtem PCa-Risiko und mit erhöhtem Risiko für aggressiven und tödlich verlaufenden PCa einher (Alcaraz et al. , 2009). Das Tempo des BPH-Wachstums kann daher möglicherweise ein prognostischer Faktor für PCa sein.
Die meisten PCas entstehen in der peripheren Zone (68 %), nur 24 % in der Übergangszone, wo sich auch die meisten BPHs entwickeln (McNeal et al. , 1988; Guess, 2001). Speziell ein PCa, das in der Übergangszone entsteht, könnte demnach mit einer BPH in Zusammenhang stehen (Bostwick et al. , 2004). Etwa ein Drittel der PCas in der Übergangszone entsteht nachweislich in BPH-Knoten (Bostwick et al. , 1992).
Ursächlich für die Zusammenhänge zwischen BPH und PCa sind die westliche Ernährungs- und Lebensweise, welche beide Erkrankungen durch ein wachstumsförderndes, proentzündliches Milieu fördern, sowie zusätzlich die direkten Auswirkungen der BPH auf das Milieu in der Prostata. Die BPH fördert entzündliche und oxidative Prozesse, welche die Entstehung eines PCas begünstigen (s. folgendes Kapitel). Die ausreichende Aufnahme von natürlichen Antioxidantien ist daher bei bereits bestehender BPH besonders wichtig, um einem Prostatakrebs vorzubeugen.
Auch wenn eine BPH nicht die direkte Vorstufe von Prostatakrebs ist, ist sie doch über ihre prooxidativen und proentzündlichen Auswirkungen in der Prostata ein Risikofaktor für die schleichende, meist deutlich langsamere Entwicklung eines Tumors.
2.5.4 Entzündungen in der Entstehung von Hyperplasie und Prostatakrebs
Entzündungsfaktoren und ihre Mediatoren spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von chronischen Prostataerkrankungen. Daher gehört eine chronische Prostatitis zu den wichtigen Faktoren, die zur Entwicklung von BPH und PCa beitragen, und stellt auch eine mögliche Verbindung zwischen beiden Diagnosen dar.
Immer mehr Studien deuten darauf hin, dass zwischen Entzündungsprozessen und Prostatawachstum (gut- und bösartig) ein enger Zusammenhang besteht (z. B. Alcaraz et al. , 2009; Elkahwaji, 2013). So zeigen epidemiologische Studien Überschneidungen zwischen Prostatitis und BPH. Die USA Health Professionals Study ergab, dass Männer mit BPH 7,7-mal so häufig eine Prostatitis gehabt hatten. Umgekehrt hatten Männer mit Prostatitis in der Vorgeschichte 3,4-mal so häufig eine BPH (Collins et al. , 2002). Eine leichte chronische Entzündung ist die häufigste Form von Entzündung, die bei klinischen BPH-Patienten gefunden wird (Fibbi et al. , 2010). Bei PCa wird häufig eine chronische Inflammation im Biopsat festgestellt. Die entzündliche Atrophie (Gewebsrückbildung) ist ein möglicher Vorläufer einer intraepithelialen Neoplasie, einer PCa-Vorstufe (Elkahwaji, 2013; vgl. Kapitel 3.3 ab Seite 26).
Eine Entzündung kann in jedem Gewebe entstehen als Reaktion auf traumatische, infektiöse, post-ischämische, toxische oder autoimmune Verletzungen. Sie wird chronisch, wenn die ursächlichen Faktoren fortbestehen und die Mechanismen zur Auflösung der Entzündung versagen. Die chronische Entzündung fördert die Zellteilung, die Ausschüttung von Immunzellen, Cytokinen und Chemokinen, die exzessive Bildung freier Radikale sowie aktive proteolytische Enzyme, die im Zusammenspiel zu Zellschäden, DNA-Schäden und verminderten DNA-Reparaturen führen. Zudem werden Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, die das Zellwachstum fördern und zusätzliche zelluläre und genomische Schäden verursachen. Dies führt zu ständigen Gewebsschäden, unkontrolliertem Zellwachstum und genomischer Instabilität. So kann aus der chronischen Entzündung ein Krebsgeschwulst entstehen (Nelson et al. , 2004; Palapattu et al. , 2005; de Marzo et al. , 2003; Albini und Sporn, 2007). Die chronische Inflammation aktiviert beispielsweise den NF-kappaB-Signalweg (Elkahwaji, 2013). Die Aktivität verschiedener Cytokine steht sowohl in Zusammenhang mit der Entstehung von BPH als auch PCa (Elkahwaji, 2013). Eine chronische Entzündung sorgt auch für eine Umgebung, die die Progression eines Tumors begünstigt (de Marzo et al. , 2007).
Zellschäden und darauf folgende Entzündungen in der Prostata können durch verschiedene Faktoren hervorgerufen werden. Zu den Krankheitserregern, die eine Prostatitis auslösen können, zählen Bakterien, die sexuell (z. B. Chlamydien, Gonokokken, Trichomonaden) oder nicht-sexuell (z. B. E. coli) übertragen werden können. Viren, die in der Prostata entdeckt wurden, sind u. a. verschiedene Herpes-Viren oder das humane Papillomvirus (HPV) (Strickler und Goedert, 2001; Zambrano et al. , 2002).
Auch der Reflux von Urin begünstigt die Entstehung einer Entzündung, da er zu einer chemischen Irritation führt. Die chemischen Bestandteile des Urins, z. B. Harnsäure, können toxisch wirken und das Prostataepithel beschädigen (Kirby et al. , 1982; Isaacs, 1983). Daraufhin werden entzündungsfördernde Cytokine produziert, die wiederum den Einstrom entzündlicher Zellen steigern. Ebenso wie Krankheitserreger kann der Rückfluss von Harn auch die Intensität einer chronischen Inflammation in der Prostata steigern.
Читать дальше