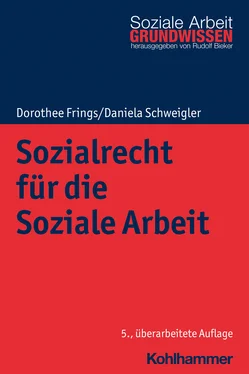Das System der Sozialversicherungen ist im Kern bis heute in seinen damals geschaffenen Strukturen erhalten geblieben und bildet in Deutschland das Grundgerüst der gesamten sozialen Vorsorge.
Während die Systeme eines funktionierenden Sozialstaats entwickelt wurden, traten die sozialen Grundrechte als garantierte Bürger- und Menschenrechte gegenüber den Freiheitsrechten für lange Zeit in den Hintergrund. Nach dem Ende des Nationalsozialismus betonten die Mütter und Väter der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland die dem Einzelnen verbürgten und durchsetzbaren Freiheitsrechte, konnten sich aber nicht zur expliziten Aufnahme sozialer Rechte in den Grundrechtskatalog durchringen. Lediglich das Sozialstaatsprinzip in Art. 20 Abs. 1 GG verpflichtet die Bundesrepublik auf das Konzept des Sozialstaats. Was dies jedoch im Einzelnen bedeutet, war und ist bis heute umstritten. Eine grobe Einteilung lässt drei verschiedene Sozialstaatstheorien erkennen:
a) Das Sozialstaatsprinzip der Verfassung erteilt dem Gesetzgeber einen Auftrag, dem Bürger ein soziales Sicherungssystem zur Verfügung zu stellen. Die Gestaltung dieses Systems liegt allein in der Hand des demokratisch gewählten Gesetzgebers (der Parlamente). Die Verfassung verpflichtet weder zu bestimmten Leistungen noch zu einem bestimmten Schutzniveau (Bachof, VVDStRL 12 (1954), S. 39, 43).
b) Das Sozialstaatsprinzip erhält seinen Wesensgehalt erst durch die enge Verzahnung mit der Verpflichtung allen staatlichen Handelns auf die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) und die übrigen Freiheitsrechte. Nach diesem Ansatz werden die sozialen Grundrechte als notwendige Voraussetzung für die Verwirklichung der Freiheitsrechte gesehen (Böckenförde 1991, S. 146, 149) und der Sozialstaat dieser Verwirklichung verpflichtet (Freiheitsfunktionalität des Sozialstaats, siehe Heinig 2008, S. 222).
c) Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Gesetzgeber zu einer »Befähigungsgerechtigkeit«. Unter Bezugnahme auf den Capability Approach von Amartya Sen soll es in der Verantwortung des Staates liegen, möglichst optimale Bedingungen für den Einzelnen zu schaffen, um entsprechend seinen Fähigkeiten ein gutes Leben führen zu können (Nussbaum 2007, S. 159 f.; Wapler, VVDStRL 78 (2019), S. 53, 68 ff.).
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist den Weg des freiheitsfunktionalen Sozialstaatsverständnisses (b) gegangen und hat damit den Mangel an ausdrücklichen sozialen Grundrechten in der Verfassung kompensiert. Der berühmte Verfassungsrechtler Günter Dürig formulierte in einer Kommentierung aus dem Jahr 1958:
»die Menschenwürde als solche ist auch getroffen, wenn der Mensch gezwungen ist, ökonomisch unter Lebensbedingungen zu existieren, die ihn zum Objekt erniedrigen.« (Dürig 1958, Art. 1 I Rn. 43)
Das freiheitsfunktionale Verständnis des Sozialstaats grenzt sich einerseits ab gegen ein ordnungsrechtlich motiviertes »staatsfunktionales« Verständnis von sozialer Sicherheit und andererseits von einem paternalistischen Wohlfahrtsstaat, der den Bürger auf eine »gute Lebensführung« verpflichtet.
Die Konsequenz aus der engen Anbindung des Sozialstaatsprinzips an die Grundrechte und insbesondere an die Menschenwürde war zunächst die Ausstattung des Einzelnen mit Rechtsansprüchen auf Sozialleistungen, durch die der Mensch vom dankbar empfangenden Untertan zum eigenverantwortlich handelnden Bürger wird (BVerwG v. 24.6.1954 – V C 78.54). Deutlichster Ausdruck der gestärkten Rechtsposition des Einzelnen gegenüber dem Staat war 1962 die Ersetzung des vom Almosenprinzip geprägten Fürsorgerechts durch das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) mit individuellen Rechtsansprüchen auf Geldleistungen. Ein verfassungsrechtlich gesicherter Anspruch auf ein bestimmtes Niveau sozialer Absicherung war damit noch nicht verbunden. Erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt sollte sich in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Anspruch des Einzelnen auf eine der Menschenwürde entsprechende finanzielle Existenzsicherung entwickeln (BVerfG v. 29.5.1990 – 1 BvL 20/84; BVerfG v. 9.2.2010 – 1 BvL 1/09). In der sog. Hartz-IV-Regelsatz-Entscheidung stellt das BVerfG fest:
»Art. 1 Abs. 1 GG erklärt die Würde des Menschen für unantastbar und verpflichtet alle staatliche Gewalt, sie zu achten und zu schützen (vgl. BVerfGE 1, 97 <104>; 115, 118 <152>). Als Grundrecht ist die Norm nicht nur Abwehrrecht gegen Eingriffe des Staates. Der Staat muss die Menschenwürde auch positiv schützen (vgl. BVerfGE 107, 275 <284>; 109, 279 <310>). Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins notwendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus seiner Erwerbstätigkeit noch aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendungen Dritter erhalten kann, ist der Staat im Rahmen seines Auftrages zum Schutz der Menschenwürde und in Ausfüllung seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die materiellen Voraussetzungen dafür dem Hilfebedürftigen zur Verfügung stehen. Dieser objektiven Verpflichtung aus Art. 1 Abs. 1 GG korrespondiert ein Leistungsanspruch des Grundrechtsträgers, da das Grundrecht die Würde jedes individuellen Menschen schützt (vgl. BVerfGE 87, 209 <228>) und sie in solchen Notlagen nur durch materielle Unterstützung gesichert werden kann.« (BVerfG v. 9.2.2010 – 1 BvL 1/09)
Die Leistungen müssen aber keine vollständige gesellschaftliche Inklusion umfassen, vielmehr genügt es, wenn über das physische Existenzminimum hinaus ein Mindestmaß sozialer Teilhabe gewährleistet wird (BVerfG v. 9.2.2010 – 1 BvL 1/09).
Aus der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG und der Bindung des Staates an das Sozialstaatsprinzip leitet sich ein Anspruch auf Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und auf ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe ab (soziale Sicherheit).
Auch eine grundsätzlich zulässige Unterscheidung zwischen deutschen und nicht deutschen Staatsangehörigen findet ihre absolute Grenze im Respekt vor der Menschenwürde.
»Art. 1 Abs. 1 GG i. V. m Art. 20 Abs. 1 GG begründet einen Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums als Menschenrecht; es steht deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu …. Migrationspolitische Erwägungen können eine geringere Bemessung der Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge nicht rechtfertigen. Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.« (BVerfG v. 18.7.2012 – 1 BvL 10/10)
Allerdings, so das BVerfG in der sog. Hartz-IV-Sanktionen-Entscheidung, darf der Gesetzgeber Sozialleistungen zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums an die Mitwirkung der Leistungsberechtigten koppeln und die Verletzung von Mitwirkungspflichten bis zu einem gewissen Grade auch durch Leistungsminderungen sanktionieren.
»Das Grundgesetz steht auch einer Entscheidung des Gesetzgebers nicht entgegen, von denjenigen, die staatliche Leistungen der sozialen Sicherung in Anspruch nehmen, zu verlangen, an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken oder die Bedürftigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen. … Das Grundgesetz steht der Entscheidung nicht entgegen, nicht nur positive Anreize zu setzen oder reine Obliegenheiten zu normieren. Der Gesetzgeber kann für den Fall, dass Menschen eine ihnen klar bekannte und zumutbare Mitwirkungspflicht ohne wichtigen Grund nicht erfüllen, auch belastende Sanktionen vorsehen« (BVerfG v. 5.11.2019 – 1 BvL 7/16).
Neben der Menschenwürde bildet der Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) den zweiten zentralen Maßstab für die Gestaltung des Sozialstaats. Die Gewährung von Sozialleistungen muss sich stets an gerechten Verteilungsgrundsätzen orientieren. Alle Unterscheidungen bei der Zuweisung von Hilfen benötigen sachgerechte Kriterien. Bestimmte Gruppen dürfen nur dann anders behandelt werden als andere Gruppen, wenn die Unterschiede in ihren Lebenslagen so gewichtig sind, dass sich – gemessen an den Zielen des Sozialgesetzes – die Benachteiligung oder Bevorzugung daraus rechtfertigen lässt. So werden etwa bestimmte Leistungen in Abhängigkeit von den Einkommensverhältnissen erbracht (z. B. Wohngeld, Ausbildungsförderung), weil die Gesetze der Zielsetzung folgen, die Auswirkungen geringer finanzieller Ressourcen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft auszugleichen oder zu mindern. Der Gleichheitssatz beinhaltet nicht nur das Gebot, Gleiches gleich zu behandeln, sondern ebenso die Verpflichtung, Ungleiches ungleich zu behandeln. Der Anspruch auf Gleichbehandlung steht also dem Solidaritätsprinzip nicht entgegen, welches u. a. dazu führt, dass gesetzlich Krankenversicherte alle denselben Leistungsumfang erhalten (abgesehen vom Krankengeld), obwohl sie Beiträge in ganz unterschiedlicher Höhe zahlen.
Читать дальше