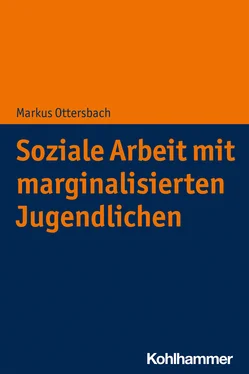»Die Konstellationen der Risikogesellschaft werden erzeugt, weil im Denken und Handeln der Menschen und der Institutionen die Selbstverständlichkeiten der Industriegesellschaft (der Fortschrittskonsens, die Abstraktion von ökologischen Folgen und Gefahren, der Kontrolloptimismus) dominieren. Die Risikogesellschaft ist keine Option, die im Zuge politischer Auseinandersetzungen gewählt oder verworfen werden könnte. Sie entsteht im Selbstlauf verselbständigter, folgenblinder, gefahrentauber Modernisierungsprozesse. Diese erzeugen in der Summe und Latenz Selbstgefährdungen, die die Grundlagen der Industriegesellschaft in Frage stellen, aufheben, verändern« (Beck 1993, S. 36).
Die Forderung nach dem Umbau der Gesellschaft in Richtung ökologischer, ökonomischer, kultureller und sozialer Nachhaltigkeit erreicht inzwischen alle gesellschaftlichen Funktionssysteme in zunehmendem Maße.
Zu den weiteren Rahmenbedingungen moderner Gesellschaften gehören Aspekte wie Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung und deren Zusammenspiel.
Die These der Individualisierung moderner Gesellschaften ist vor allem von Beck (1986, S. 205ff.) aufgenommen und weiterentwickelt worden. Dem Autor gemäß ist nach dem Zweiten Weltkrieg ein neuer Modus der Vergesellschaftung aufgetaucht: die Individualisierung. Zunächst bedeutet er nichts anderes als Enttraditionalisierung. Die lange Zeit gültigen sozialen Kontrollnetze mit einer klaren und geschlossenen Weltanschauung und funktionierenden Autoritätsverhältnissen werden zugunsten eines Zuwachses an neuen Optionen, Freiheiten, Wahlmöglichkeiten und Chancen einer individuellen Lebensgestaltung abgelöst. Zwar gab es bereits in der Renaissance, in der höfischen Kultur des Mittelalters und im Protestantismus individualisierte Lebensstile. Allerdings nimmt die Individualisierung jetzt eine neue Gestalt und vor allem ein neues Ausmaß an.
Eine weitere wichtige Rahmenbedingung gegenwärtiger Zivilgesellschaften ist die Pluralisierung. Sie bezieht sich nach Beck (ebd., S. 161ff.) auf die Vervielfältigung der Formen sozialer Beziehungen 6 und auf Lebensstile und ist mit der Individualisierung eng verbunden 7 . Die Pluralisierung der Beziehungsformen zeigt sich durch die Entstehung zahlreicher alternativer oder neuer Partnerschaftsformen. Single-Haushalte, nicht-eheliche Gemeinschaften, homosexuelle Paare, Lebensabschnittsgemeinschaften, Ein-Eltern-Familien, Familien mit Kindern, Ehen ohne Kinder, Zweck- und ›Sinn‹-Wohngemeinschaften treten neben die bislang statistisch gesehen am häufigsten anzutreffende Familie mit zwei Kindern, wie sie von Parsons (1956) noch als mehr oder weniger allgemeingültige »Normalfamilie« beschrieben worden ist. Während diese neuen Lebensformen für die inzwischen erwachsene Generation noch neu waren, wachsen Jugendliche heutzutage mit ihnen auf, d. h., sie empfinden sie als zum Alltag gehörend und nicht mehr als außergewöhnlich.
Als eine weitere gesellschaftliche Rahmenbedingung ist die Globalisierung anzuführen. Unter Globalisierung ist zunächst eine weltweite Verflechtung einzelner Subsysteme wie der Wirtschaft, der Wissenschaften, der Politik, der Medien und der Kultur zu verstehen. Diese Verflechtungen beziehen sich auf Staaten, Gesellschaften, Institutionen, Gruppen und Individuen. Historisch gesehen ist es wichtig zu sehen, dass Globalisierung nicht erst in diesem Jahrhundert erfunden wurde. Bereits im 15. und 16. Jahrhundert und spätestens im Zuge der Industrialisierung, der Arbeitsteilung und der Herausbildung des Kapitalismus als hegemonialer (Welt-)Wirtschaftsform werden wirtschaftliche Prozesse internationalisiert (vgl. Braudel 1986). Die damals entstehenden Formen des zweckrational geleiteten Wirtschaftshandelns bestimmen noch immer das Marktgeschehen, das sich aus Konkurrenzdruck, Innovationsdynamik, Rationalisierung und Werbung zusammensetzt, nur heute eben in einer globaleren Dimension und kaum noch durch politische, sondern fast nur noch durch ökonomische Macht gesteuert (vgl. Wallerstein 1974). Um das Ausmaß tatsächlicher Globalisierungstendenzen ausfindig zu machen, ist es erforderlich, Globalisierung in ihrer Vieldimensionalität 8 zu begreifen, d. h. die Ausdifferenzierung der einzelnen Subsysteme in ihrer Komplexität und in ihrer Reziprozität zu interpretieren. Globalisierung ist eben deshalb so aktuell und effektiv, weil sie in immer mehr gesellschaftliche Subsysteme vordringt, dort die Strukturen verändert und somit Veränderungen für andere Subsysteme und Institutionen bewirkt. Diese Entwicklungen haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Lebenslagen und Lebensstile Jugendlicher.
Im Umgang mit diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unterscheiden sich demokratische Gesellschaften mit einer stabilen Gewaltenteilung zwischen Legislative, Judikative und Exekutive erheblich von totalitären Gesellschaften, in denen die staatliche Gewalt in den Händen Weniger oder sogar nur einer Person konzentriert ist. Bemerkbar machen sich diese Differenzen auch zwischen Gesellschaften, die demokratisch legitimiert sind und rechtsstaatliche Verhältnisse tatsächlich schützen, und denjenigen Gesellschaften, die zwar demokratisch legitimiert sind, jedoch versuchen, diese Gewaltenteilung zu reduzieren oder gar außer Kraft zu setzen 9 .
2.2 Mesokontext: Lebenslagen
Mesosoziologische Theorien orientieren sich an den gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen, die für die konkrete gesellschaftliche Inklusion der Menschen zuständig sind und deren Ausstattung, Aufgaben, Befugnisse und Ausrichtungen politisch initiiert sind. Institutionen, die Arbeit, Bildung, gesundheitliche Versorgung, Wohnraum oder auch Freizeitmöglichkeiten vermitteln bzw. bereitstellen, haben die Aufgabe, im Rahmen der Gestaltung der Lebenslage der Menschen diese zu inkludieren. Diese Institutionen (die Firma, die Schule, die Familie etc.) versorgen Menschen – in der Sprache Bourdieus (vgl. Bourdieu 1981; Bourdieu 1989) – mit unterschiedlichen Kapitalformen, wie ökonomisches, kulturelles oder soziales Kapital 10 . Als ökonomisches Kapital werden Vermögen, Besitz und Einkommen betrachtet, als Formen kulturellen Kapitals die Vermittlung von Bildungsqualifikationen und als soziales Kapital soziale Netzwerke oder soziale Beziehungen der Menschen untereinander. Von Bourdieu weniger beachtet, aber dennoch nicht unwichtig, könnte man das politische Kapital der Menschen noch anführen, das durch das Engagement bei Wahlen oder bei direkten Formen der politischen Partizipation deutlich wird.
Solche Kapitalformen können auch als Aspekte der sozialen Lage oder der Lebenslage aufgefasst werden. Die Lebenslage der Menschen ist sehr unterschiedlich, d. h. es gibt Reiche und Arme, Gesunde und Kranke, Menschen mit hoher und Menschen mit geringer Bildungsqualifikation, Menschen, die eher in wohlhabenden Quartieren, und solche, die eher in marginalisierten Quartieren wohnen. Verbunden mit der Prägung der Individuen durch Institutionen ist auch eine Vermittlung von Gesetzen, Normen und Ritualen. Menschliches Handeln wird durch Institutionen in Form von Gesetzen verpflichtend und in Form von Verhaltensnormen normativ reguliert 11 . Gemeinschaften erwarten zudem auch die Beachtung und Einhaltung von Regeln und Ritualen. Dies gilt nicht nur für religiöse Gemeinschaften, sondern auch für Fanclubs, Karnevalsvereine oder Männerbünde. Institutionen vermitteln implizites Wissen, dass inkorporiert werden muss, später routiniert abläuft und nicht mehr bewusst reflektiert wird. Zudem prägen Institutionen soziale Beziehungsgeflechte zwischen Individuen, indem sie diese nicht nur ermöglichen, sondern auch hierarchisieren und mit Inhalten versehen.
Am Beispiel der Institution Schule lässt sich verdeutlichen, dass diese Institution Lehrer*innen und Schüler*innen in bestimmten Räumlichkeiten zusammenbringt, deren Verhältnis einer Hierarchie unterwirft und bestimmte Regeln und Rituale des Verhaltens aller Akteurinnen und Akteure mehr oder weniger festlegt. Zudem vermittelt die Schule bestimmte Inhalte, d. h. ein bestimmtes Wissen, das durch Rituale wie Prüfungen abgefragt wird und auf dessen Basis Qualifikationen verteilt werden, die letztlich über In- und Exklusion von Schüler*innen entscheiden. Die institutionell vollzogene Inklusion seitens der Schule impliziert auch die fortdauernde Stratifikation z. B. in Bezug auf die Reproduktion sozialer Ungleichheit. Obwohl das Bildungssystem Chancengleichheit fördern soll, weisen die zahlreichen PISA-Studien (vgl. z. B. die PISA-Studien von 2006, Prenzel et.al. 2008, und 2018, Reiss, Weis, Klieme & Köller 2019) seit Jahren für Deutschland nach, dass die Schule maßgeblich zur Reproduktion des Schichtengefüges beiträgt. Am Beispiel des Bildungssystems zeigt sich sehr deutlich, dass die funktionale Differenzierung gesellschaftlicher Subsysteme die Fortdauer stratifkatorischer Prozesse in modernen Gesellschaften nicht verhindert. Auch die Sozialpolitik vermag dieses Manko nicht zu kompensieren. Zwar hat im Zuge des Ausbaus der Wohlfahrtssysteme in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Verbesserung der Lebensverhältnisse aller Bürger*innen in Deutschland stattgefunden. Dennoch ist die Hierarchisierung in Bezug auf Wohlstand damit nicht abgeschafft worden. Die sozio-ökonomische Distanz zwischen den Schichten hängt nach wie vor maßgeblich von konjunkturellen Schwankungen und sozialpolitischen Maßnahmen ab (vgl. Finanzkrise oder Corona-Krise).
Читать дальше