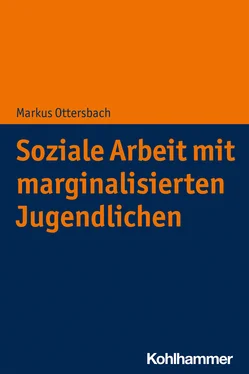• Warum ist es erforderlich, sich im wissenschaftlichen Kontext von Begriffen der Alltagssprache zu distanzieren und spezielle wissenschaftliche Begriffe zu verwenden?
• Reflektieren Sie den Zusammenhang von Begriffswahl und Professionalität in der Sozialen Arbeit!
• Welche Argumente sprechen für die Verwendung des Begriffs der »marginalisierten Jugendlichen« in Bezug auf die hier thematisierte Zielgruppe?



Brocke, Hartmut (1996): Randgruppen. In: Kreft, Dieter & Mielenz, Ingrid (Hg.): Wörterbuch Soziale Arbeit. Weinheim/Basel: Beltz.
Geßner, Thomas (2004): Was benachteiligt wen oder warum? Versuch einer Präzisierung des Konstrukts »Benachteiligung«. In: Zeitschrift für Sozialpädagogik, Heft 1, S. 32–44.
Korte, Petra (2006): Der Benachteiligtendiskurs aus allgemeinpädagogischer Perspektive. In: Spies, Anke & Tretop, Dietmar (Hg.): »Risikobiographien«. Benachteiligte Jugendliche zwischen Ausgrenzung und Förderperspektiven. Wiesbaden: Springer VS, S. 25–40.
Lemert, Edwin M. (1982): Der Begriff der sekundären Devianz. In: Lüdersen, Klaus & Sack, Fritz (Hg.): Abweichendes Verhalten I. Die selektiven Normen der Gesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 433–476.
Lüders, Christian (2013): Exklusion – der ewige Stachel der Kinder- und Jugendhilfe. In: DJI impulse. Bulletin des Deutschen Jugendinstituts, Heft 4, S. 7–9.
Ottersbach, Markus (2009): Jugendliche in marginalisierten Quartieren Deutschlands. In: Ottersbach, Markus & Zitzmann, Thomas (Hg.): Jugendliche im Abseits. Zur Situation in französischen und deutschen marginalisierten Stadtquartieren. Wiesbaden: Springer VS, S. 51–74.
Spies, Anke & Tretop, Dietmar (2006): »Risikobiographien« – Von welchen Jugendlichen sprechen wir? In: dies. (Hg.): »Risikobiographien«. Benachteiligte Jugendliche zwischen Ausgrenzung und Förderperspektiven. Wiesbaden: Springer VS, S. 9–24.
1Auch andere Bezeichnungen wurden gewählt, wie z. B. »sozial schwache Jugendliche« oder »Jugendliche in prekären Lebenslagen«, auf die hier nicht eingegangen werden kann.
2Damals gab es noch eine klare Trennung zwischen der Sozialarbeit, deren Tradition eher in der Armenfürsorge begründet ist, und der Sozialpädagogik, deren Zielgruppe eher Jugendliche sind und deren Angebote sich eher auf den Bildungsbereich beziehen.
3Die Prozesse der Polarisierung und Stigmatisierung lassen sich auch in Bezug auf die Entstehung marginalisierter Quartiere nachweisen (vgl. Ottersbach 2004, 2009).
4Es soll hier jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, dass solche Entwicklungsverläufe nur sozial konstruiert werden, im Grunde genommen also gar keine problematische Entwicklung darstellen. Eine solche Perspektive müsste den tatsächlichen Leidensdruck vieler Jugendlicher in solchen Lebenslagen ignorieren und würde der Situation der Jugendlichen auch nicht gerecht. Die Frage ist letztendlich, ob die Fremd- und die Selbstwahrnehmung dieser Jugendlichen sich decken oder eben auseinanderklaffen. Im letzten Fall handelt es sich dann eindeutig um eine Stigmatisierung von außen.
5Mithilfe der Labeling-Theorie (vgl. Lemert 1982, S. 433ff.) könnte man an solchen Beispielen aufzeigen, dass die »primäre Devianz« (das wären in diesem Beispiel die aufgrund der ökonomischen, rechtlichen und sozialen Ungleichheit entstehenden abweichenden Verhaltensweisen der Bewohner*innen) durch Stigmatisierung seitens Medien, Politik und Wissenschaft eine »sekundäre Devianz« provozieren kann (dies wäre die Inkorporation der von außen erfolgten Schuldzuweisung, die – je nach dem – zu verstärkter Apathie und Resignation oder Gewalt und Kriminalität führen kann).
2 Theoretische und analytische Vorbemerkungen: Makro-, Meso- und Mikroperspektive
Gesellschaftliche Prozesse zu verstehen oder gar zu erklären, ist seit ihrer Existenz das wichtigste Anliegen der Soziologie. Da gesellschaftliche Prozesse in aktuellen Gesellschaften dynamisch und hochkomplex sind, gibt es keine soziologische Theorie, die aktuelle Gesellschaften als Ganzes sowohl aus der Makro-, der Meso- oder der Mikroperspektive analysieren kann. Soziologische Theorien der Gegenwart konzentrieren sich deshalb meist auf eine der genannten Perspektiven.
Um einer Analyse der Lebenssituation marginalisierter Jugendlicher gerecht zu werden, müssen jedoch alle drei Perspektiven berücksichtigt werden.
2.1 Makrokontext: Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Im Kontext der makrosoziologischen Perspektive sind zunächst die aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu analysieren. Moderne Gesellschaften kennzeichnen sich zunächst durch funktionale Differenzierung und durch ein Reflexiv-Werden. Damit verbunden sind die Rahmenbedingungen der Individualisierung, der Pluralisierung und der Globalisierung.
Zunächst ist festzustellen, dass moderne Gesellschaften sich durch eine funktionale Differenzierung kennzeichnen. Die Theorie funktionaler Differenzierung geht auf die systemtheoretischen Überlegungen Parsons und später Luhmanns zurück. Moderne Gesellschaften verändern sich ständig und werden angetrieben von zunehmender Komplexität. Historisch betrachtet, wurden in frühesten Gesellschaften Differenzierungen nach Geschlecht und Alter hierarchisiert. In archaischen Gesellschaften erfolgten Differenzierungen durch verschiedene Segmente (Familien, Clans, Dörfer), zwischen denen es kein soziales Gefälle gab. In der frühen Neuzeit wurden hierarchische Differenzierungen in Form von Schichtzugehörigkeiten (Stratifikation) sowie durch Zugehörigkeit in Zentrum und Peripherie abgelöst. Mit zunehmender Komplexität der Gesellschaft wurden diese frühen Formen der Differenzierung immer stärker durch funktionale Differenzierungen ersetzt. Allerdings werden Stratifikationen nicht komplett durch funktionale Differenzierung ersetzt, sondern sind nach wie vor existent. So existieren nach wie vor Formen stratifikatorischer Differenzierung z. B. in Form von sozialer Ungleichheit, aber auch als Differenzierung der Bedeutung von Nationalstaaten (in der Politik), Unternehmen (in der Wirtschaft) oder von Schulen (im Bildungssystem) etc. Die Systemtheorie versteht unter funktionaler Differenzierung (vgl. Luhmann 1984), dass jedes Subsystem Gesellschaft nur unter seinem spezifischen Blickwinkel beobachtet. Das Teilsystem der Wirtschaft betrachtet Gesellschaft nur hinsichtlich ökonomischer Prozesse, das Rechtssystem nur in Bezug auf juristische Phänomene und die Wissenschaft ausschließlich, ob Sachverhalte oder Prozesse wahr oder falsch sind. Zudem werden die gesellschaftlichen Funktionssysteme wie Recht, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Wissenschaft und auch die Soziale Arbeit immer komplexer und spezieller. Das Rechtssystem fächert sich auf in zahlreiche, spezielle Rechtsgebiete (Arbeitsrecht, Familienrecht, Strafrecht etc.), für die speziell ausgebildete Expert*innen zuständig sind.
Ein weiteres Kennzeichen moderner Gesellschaften ist das Reflexiv-Werden der Gesellschaft. Damit ist gemeint, dass die Existenz der aus der »ersten Moderne« (Beck, Giddens & Lash 1996) hervorgegangenen Risiken (wie z. B. der Klimawandel) in der »zweiten, reflexiven Moderne« erkannt, analysiert und bekämpft werden müssen (vgl. auch Beck & Bonß 2001). Die Theorie reflexiver Modernisierung zeigt auf, dass die erste, industrielle Moderne erhebliche Nebenfolgen bewirkt, die ihre eigenen institutionellen Grundlagen gefährden und somit zu politischem Handeln zwingen. Dies entspricht nach Beck einer Selbstkonfrontation von Modernisierungsfolgen mit den Modernisierungsgrundlagen und charakterisiert die zweite Moderne als Risikogesellschaft:
Читать дальше