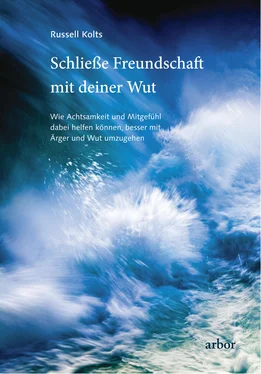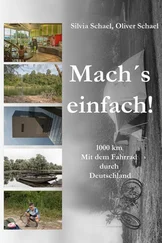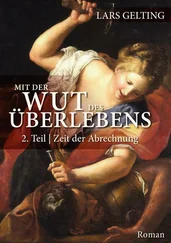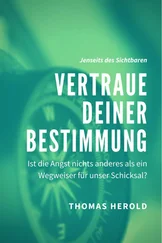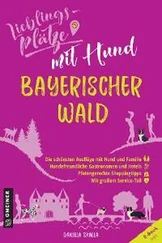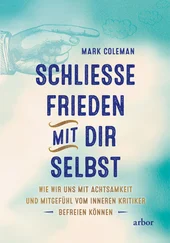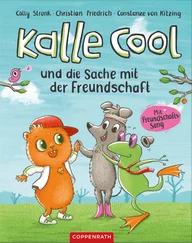Übung 1.2: Ärger und Wut und Aufmerksamkeit
Rufen Sie sich eine Situation ins Gedächtnis, die noch nicht lange zurückliegt und in der Sie sich geärgert haben.
• Worauf war Ihre Aufmerksamkeit gerichtet? Worauf haben Sie geachtet?
• Betrachten Sie die Qualität Ihrer Aufmerksamkeit. War sie weit und offen oder verengt?
• Gab es Aspekte der Situation, derer Sie sich nicht bewusst waren? Oder Dinge, die Sie nicht wahrgenommen haben?
Aggression und andere Emotionen, die mit Bedrohung und Gefahr zu tun haben, richten unsere Aufmerksamkeit besonders auf Informationen, die das Gefühl, bedroht zu sein, verstärken. Daher neigen wir dazu, Informationen zu ignorieren, die mit diesem inneren Zustand nicht konsistent sind. Unser Gehirn ist also zur Aggressivität geneigt. Wir suchen uns das natürlich nicht selbst aus und es ist sicher nicht unser Fehler. Es ist uns nicht vorzuwerfen, unser Gehirn funktioniert einfach so.
Und es funktioniert aus gutem Grund so, nämlich um unser Überleben zu sichern, um die Menschen, die uns nahestehen, zu schützen, und damit wir unseren Status und unseren Besitz verteidigen können. Wenn es eine reale Bedrohung oder Gefahr für uns gibt, brauchen wir selbstverständlich ein waches Bewusstsein, das allein darauf fokussiert ist und es uns ermöglicht, entsprechend zu reagieren. Wenn man auf den Gleisen eines heranrasenden Zuges steht, sollte die Aufmerksamkeit auf den Zug gerichtet sein und nicht von den schönen Wildblumen abgelenkt werden.
Das Problem ist, dass wir mehr Erlebnisse von der Art meiner Verspätung zum Seminar haben als extreme Erfahrungen wie meine Begegnung mit dem „Hai“. Denken Sie an Situationen aus jüngerer Zeit, in denen Sie sich aggressiv erlebt haben. Worauf war Ihre Aggression da gerichtet? Was hat sie ausgelöst? War es eine physische Bedrohung oder Gefahr oder war es etwas anderes? Viele der Bedrohungen, mit denen wir im modernen Leben konfrontiert sind, haben wenig mit Sicherheit für Leib und Leben zu tun, sondern eher mit Konflikten am Arbeitsplatz, mit sozialem Status, mit dem Selbstbild oder mit unseren Beziehungen. Aggression kann auch als emotionale Abwehr schmerzhafter Gefühle wie Verlust, Verlegenheit oder Scham benutzt werden. Und als wäre das noch nicht genug, das Gehirn kann auch seine eigenen „Bedrohungen“ erzeugen – in Form von Gedanken, Bildern und Fantasien.
Dinge, die wir uns sagen: Gedanken, Argumente und Grübeleien
Wenn man aggressiv ist, ist man oft mit einer Menge „automatischer Gedanken“ konfrontiert – mit Gedanken, die einem scheinbar von selbst in den Sinn kommen und die oft mit Dingen zu tun haben, die einem nicht gefallen oder mit denen man nichts zu tun haben will. Man neigt auch dazu, Dinge sehr persönlich zu nehmen, wenn man aggressiv wird oder sich sehr über etwas ärgert: „Dies sollte nicht passieren! Dies sollte mir nicht passieren! Das sollten sie nicht tun! Ich werde benutzt! Warum musste dies ausgerechnet jetzt passieren?“
Aggressive Gedanken entstehen häufig, wenn man sich bedroht fühlt. Wenn der neue Partner zum Beispiel nicht zur vereinbarten Zeit anruft, denkt man automatisch: „Ich bin ihm nicht so wichtig, denn sonst würde er mich anrufen.“ Solche Gedanken hängen häufig mit Unsicherheiten zusammen, die ihre Wurzel in der Vergangenheit haben. „Ich bin ihm nicht so wichtig …“ kann mit einem tieferen Problem wie Selbstwert und letztlich mit schwierigen Erinnerungen aus der Kindheit zu tun haben. Dieser Gedanke kann auch eine aggressive Reaktion auf eine wahrgenommene Gefahr für die Beziehung sein. Das Interessante ist aber, dass diese automatischen Gedanken meist nicht der Wahrheit entsprechen und nur von unserem überaktiven System zur Entdeckung von Gefahren und Bedrohungen genährt werden.
Eines meiner Lieblingsbeispiele stammt von Thubten Chodron, einer buddhistischen Nonne und Äbtissin der Sravasti Abbey im Nordwesten der USA. Sie ist auch eine produktive Autorin und Lehrerin (7). Vor ein paar Jahren hörte ich einen Vortrag von ihr über die Arbeit mit Aggression. Zu Beginn fragte sie die Zuhörer nach Aggression im Straßenverkehr – ein Thema, das in jüngerer Zeit, wenigstens in den USA, Schlagzeilen gemacht hat. Sie fragte: „Gibt es hier jemanden, der richtig aggressiv wird, wenn ihn jemand auf dem Freeway schneidet?“
Sofort hoben zwei Drittel der Zuhörer die Hand. Sie forderte uns dann auf, uns auf die Gedanken zu besinnen, die uns kommen, wenn dies passiert, und eine Reihe von Leuten teilte mit, was ihnen in so einer Situation durch den Kopf geht. Es waren vor allem negative Gedanken über den anderen Fahrer – Sie kennen sie: dass er entsetzlich blöde oder ein mieser Charakter ist oder zum persönlichen Vergnügen und aus reiner Langeweile das Leben anderer absichtlich in Gefahr bringt. „Dieses Arschloch!“ „Was für ein Idiot! Hat er keine Augen?“ „Er versucht tatsächlich, mich von der Straße zu drängen!“ „Ich würde ihm gern ein Sandwich ins Gesicht schmeißen!“
Thubten Chodron tat als Nächstes etwas, womit sie, wie ich jetzt sehe, ein Bewusstsein von Mitgefühl und Verbundenheit mit den anderen Fahrern fördern wollte: Sie fragte, wie viele von uns schon einmal einen anderen Fahrer geschnitten hätten. An dieser Stelle senkten fast alle etwas betroffen den Blick und hoben zögernd die Hand (anscheinend waren wir ein außergewöhnlich wahrheitsliebender Haufen). Sie forderte uns dann auf, Gründe für unser „rücksichtsloses“ Verhalten zu nennen. Niemand rief: „… weil ich ein Arschloch bin, dem nichts am Leben anderer liegt!“
Vielmehr konnte man murmeln hören: „Das war eine Ausnahme, ich hätte sonst die Ausfahrt verpasst“ und „Ich habe sie nicht rechtzeitig gesehen“. Der gereizte Ton im Raum verschwand und an seine Stelle traten Freundlichkeit und Mitgefühl, als wir uns innerlich in die anderen Fahrer hineinversetzen. Wir bedachten dann die vielen möglichen Gründe für ihr Verhalten, die in den Blick kommen konnten, wenn man ihnen keine Dummheit oder Bosheit und kein antisoziales Verhalten unterstellte. Wir öffneten uns für das mitfühlende Verständnis, dass es manchmal schwierig ist, auf dem Freeway voranzukommen, und dass wir alle manchmal Dinge tun, die andere behindern und anderen lästig sind – absichtlich oder unabsichtlich.
Solch mitfühlendes Erwägen kann ein sehr wirksames Gegenmittel gegen Aggression sein, und die Forschung hat gezeigt, dass Sympathie für jemanden, der einen beispielsweise beleidigt, die Aktivität des Gehirns, die mit Aggression verknüpft ist, reduziert (8). Wir können mit Aggression konstruktiv umgehen, wenn wir uns klarmachen, was wir miteinander gemeinsam haben und dass es Dinge gibt, die wir alle tun – zum Beispiel andere im Straßenverkehr schneiden. Innere Zustände der Aggression oder des Mitgefühls sind stark mit Motivation verbunden: Aggression mit der Motivation, Schmerz zuzufügen, Mitgefühl mit der Motivation, zu helfen. Mitgefühl kann dazu motivieren, selbst langsamer zu fahren, um den anderen vor uns einzuscheren zu lassen, statt zu beschleunigen, um ihn zu blockieren.
Grübeln
Wie schon erwähnt, scheinen unsere Gedanken von Ärger kontrolliert zu werden. Haben Sie einmal versucht, bei der Arbeit eine komplizierte Aufgabe zu erfüllen, für eine Prüfung zu lernen, eine Fernsehsendung zu sehen oder ein Buch zu lesen, wenn Sie wirklich ärgerlich waren? Das ist schwer, weil unser Bewusstsein dazu neigt, sich ständig mit unserem Ärger zu beschäftigen. Man kann sich anstrengen, wie man will, unser Gehirn lässt uns weiter an diese beleidigende Bemerkung denken, spielt die Situation immer wieder durch, führt sie uns immer wieder vor Augen. Man kann Stunden damit verbringen, über das, was „sie“ gesagt haben, über das, was wir gern gesagt hätten, zu grübeln und zu formulieren, was wir das nächste Mal sagen werden.
Читать дальше