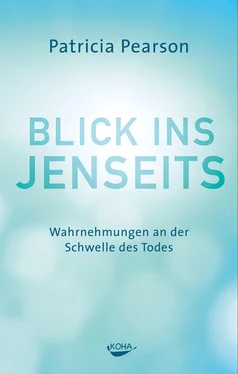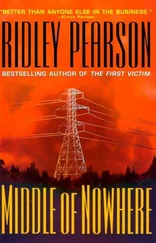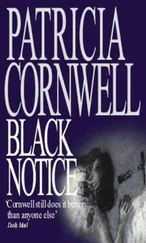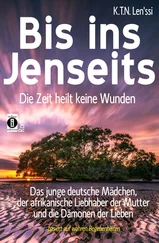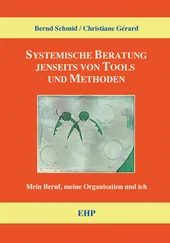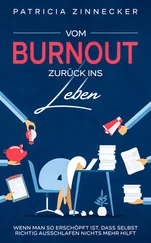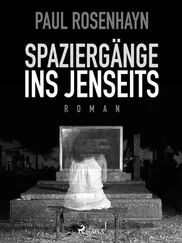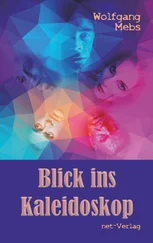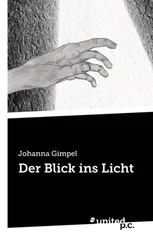»Was den Geist betrifft«, erzählte mir der Wissenschaftsjournalist Jeff Warren, der viel über Neurologie und Bewusstsein geschrieben hat, »wissen wir nicht, ob ihn das Gehirn erzeugt oder überträgt. Bringt das Gehirn den Geist hervor, wie eine Lampe Licht erzeugt? Oder wirkt es eher wie ein Prisma oder eine Linse, die ein bereits existierendes Phänomen in das volle Spektrum unserer Persönlichkeit projiziert? Viele Philosophen haben argumentiert, es sei zumindest theoretisch möglich, dass der ›Geist‹ – die Fähigkeit zur Erfahrung – eine Art grundlegende kosmische Komponente ist, wie Zeit und Raum. Neurologische Aktivitäten als solche sagen nichts darüber aus, welche Art von Funktion der Wahrheit entspricht.«
Wie können wir dieser Frage nachgehen? Die frühesten wissenschaftlichen Forschungen, von denen wir wissen, versuchten nicht, die Existenz der Seele nachzuweisen. Dies war selbstverständlich; sie wollten vielmehr wissen, wo sie verankert ist. Wo steckte das »Prisma« oder die »Linse«? Der im 3. Jahrhundert v.u.Z. lebende griechische Arzt Herophilus von Alexandrien ist als erster Mensch bekannt, der menschliche Leichen aus Interesse sezierte. Ein Teil seiner Neugier galt dem Sitz der Seele. Er beschloss, sie säße im vierten Hirnventrikel. Das war eine radikale Abkehr vom klassischen ägyptischen Verständnis, dass die Seele im Herzen sitzt. Dieser herzzentrierten Sicht folgend, wurde den Leichen bei der Mumifizierung das (unwichtige) Gehirn entfernt, während das Herz sorgfältig dringelassen wurde, damit es der Gott Anubis wiegen könne.
Im 1. Jahrhundert u.Z. forderte Kaiser Hadrian den Rabbi Joshua ben Hananiah auf, ihm den »Seelenknochen« zu zeigen, dessen Existenz einige jüdische Autoritäten behauptet hätten. Dieser »Luz« genannte Knochen solle irgendwo im Bereich der Wirbelsäule sein. Sein besonderes Merkmal war seine Unzerstörbarkeit.
»Er brachte einen«, schrieb Hadrian später, »und warf ihn ins Feuer, aber er verbrannte nicht. Er tat ihn in eine Mühle, aber er wurde nicht zermahlen. Er legte ihn auf einen Amboss und schlug mit dem Hammer darauf. Der Amboss zerbrach, und der Hammer zersplitterte, aber der Luz blieb unversehrt.« Dieser Bericht ließ viele Männer jahrhundertelang nach dem »Luz« suchen. Manche vermuteten ihn im Sacrum, manche im Steißbein und manche im Sesamknochen der großen Zehe.
Im 2. Jahrhundert entwickelte der römische Arzt Galen, der unter anderem die Gladiatoren versorgte (und so oft wie möglich in ihre aufgerissenen Leiber spähte), die Theorie, die Seele würde das Bewusstsein auf ähnliche Weise beleben, wie die römischen Badehäuser beheizt würden. Die Menschen würden mit dem Atem auch die Seelenkraft der Welt aufnehmen, und dieser Spiritus flösse dann wärmend und kühlend durch die Röhren und Organe und bewirke verschiedene Funktionen, zum Beispiel die Verdauung.
René Descartes wühlte Hunderte von Stunden in den Kadavern von Kühen herum, um dem Sitz der Seele auf die Spur zu kommen. Schließlich beschloss er, sie sitze irgendwie in der Zirbeldrüse oder würde durch diese empfangen oder übertragen. Heute wissen wir, dass die Zirbeldrüse das Melatonin-Niveau regelt. Descartes glaubte, der Geist ströme zu der Zirbeldrüse hin und von ihr aus durch ein Nervensystem, welches er mit einer Kirchenorgel verglich, mit winzig kleinen Blasebälgen.
Der im 19. Jahrhundert lebende Anatom Franz Gall aus Wien war einer der Ersten, die dem Bewusstsein einen etwas diffuseren Ort zuwiesen. Seine Vermutungen waren zwar grundsätzlich richtig, doch im Detail lag er eher daneben. Zum Bespiel meinte er, im Gehirn gäbe es 27 einzelne Organe, darunter ein »Organ für dichterische Begabung«, ein »Organ für Metaphysik« und ein »Organ für Besitzinstinkt und das Horten von Nahrungsmitteln«. Die am stärksten entwickelten Organe würden gegen den Schädel drücken und wahrnehmbare Beulen verursachen. Gall hatte eine Sammlung von 221 Schädeln, an denen er seine Ansichten demonstrierte. Als Beweis für den Sitz des »Organs für den Glauben an die Existenz Gottes« verwies er auf eine Reihe von Raphael-Gemälden, auf denen Christus oben auf dem Schädel eine deutliche Beule aufweist. Seine Theorien führten zu der explosiven Ausbreitung der Popularität der Phrenologie, der Zuordnung bestimmter Hirnareale und Schädelformen zu Charakter- und Geistesgaben.
Mitte des 19. Jahrhundert beschloss ein neugieriger amerikanischer Arzt namens Duncan MacDougall, zu versuchen, die Seele durch Wiegen zu verorten. Er schaffte es, sich die Zustimmung einiger Patienten zu verschaffen, die in einem Heim für Schwindsüchtige in Dorchester, Massachusetts, an Tuberkulose starben. Als der erste dieser Patienten kurz vor dem Sterben war, legte ihn Duncan auf eine Bahre, die auf eine Waage montiert war, und wartete dann geduldig auf seinen letzten Atemzug, um in genau diesem Augenblick auf den Zeiger der Waage zu schauen. So kam er zu dem Schluss, dass die Seele 21 Gramm wiegt (wie in dem gleichnamigen Hollywood-Film).
Um dieselbe Zeit, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, begannen andere Forscher die Frage auf den Kopf zu stellen. Statt anzunehmen, die Seele existiere, und zu versuchen, sie körperlich zu verorten, widmeten sie sich der Frage, ob es die Seele überhaupt gibt. Dafür verwendeten sie aus Beobachtungen abgeleitete Schlussfolgerungen. Eine brauchbare wissenschaftliche Analogie sind vielleicht Methoden, die in der Astronomie angewandt werden. Astronomen, die durch ein Teleskop schauen, sehen kein schwarzes Loch. Sie leiten dessen Existenz ab, weil sie beobachten, dass etwas in gewissen Teilen des Universums eine enorme Schwerkraft auf die Planeten und Sterne ausübt, und sie sich fragen, was das sein könnte. In ähnlicher Weise beobachten Ärzte und Wissenschaftler, dass Sterbende unter dem Einfluss von irgendetwas stehen, was sich nicht durch Medikamente, Körperchemie oder einen körperlichen Zustand erklären lässt. Was kann das sein?
Der erste zeitgenössische Bericht über Visionen auf dem Sterbebett stammt von Lady Florence Barrett, einer der ersten Gynäkologinnen, die mit einem Arzt des Royal College of Science in Dublin verheiratet war. Am 12. Januar 1924 stand Lady Barrett einer Frau namens Doris im Wochenbett bei, die aufgrund von Komplikationen und Blutverlust im Sterben lag. Lady Barrett schrieb später:
Plötzlich schaute sie sehr interessiert in eine bestimmte Ecke des Raums, und ein strahlendes Lächeln breitete sich über ihr ganzes Gesicht aus. »Oh, wie wundervoll, wundervoll«, sagte sie.
Ich fragte: »Was ist wundervoll?«
»Was ich sehe«, antwortete sie mit leiser, nachdrücklicher Stimme.
»Was sehen Sie?«
»Wundervolles Licht – wundervolle Wesen.« Es ist schwer, die Echtheit zu beschreiben, die ihre intensive Versunkenheit in die Erscheinung vermittelte. Dann schien sie ihren Fokus einen Moment lang stärker auf einen Ort zu fokussieren – und rief dann plötzlich: »Ach, es ist Vater! Oh, er freut sich so, dass ich komme, er freut sich so! Es wäre perfekt, wenn nur W. [ihr Mann] auch kommen könnte.«
Doris sprach mit den Anwesenden darüber, ob sie vielleicht um des Kindes willen bleiben solle. Doch dann sagte sie: »Ich kann nicht – ich kann nicht bleiben; wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, würdet ihr verstehen, dass ich nicht bleiben kann.«
Dann sah Doris etwas, was sie verwirrte: »Er hat Vida bei sich«, erzählte sie Lady Barrett. Ihre Schwester Vida war drei Wochen zuvor gestorben, doch man hatte es wegen ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft vor Doris verheimlicht. »Vida ist bei ihm«, wiederholte sie verwundert.
Nachdem er von seiner Frau von diesem Ereignis erfuhr, beschloss Sir William Barrett, die Sache formell zu untersuchen. Er holte von allen im Raum Anwesenden schriftliche Berichte ein: von Lady Barrett, der Krankenschwester, dem diensthabenden Arzt, der Oberschwester Miriam Castle und von Doris’ Mutter Mary Clark of Highbury. Die Berichte bestätigten sich gegenseitig, was den zu diesem Zeitpunkt im Ruhestand befindlichen Sir William veranlasste, andere Fälle zu untersuchen, die er 1926 unter dem Titel Deathbed Visions publizierte. Dieses Buch inspirierte dann später Osis und Haraldsson, amerikanische und indische Sterbebett-Visionen zu vergleichen. (Wie die meisten Menschen, die sich diesem Thema widmen, entsprang auch Osis’ Motivation einer eigenen Erfahrung des Phänomens. Er war als Jugendlicher in Litauen Zeuge der Sterbebett-Visionen seiner Tante gewesen.)
Читать дальше