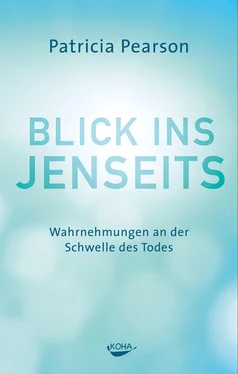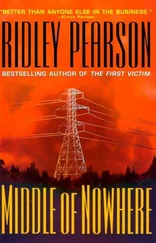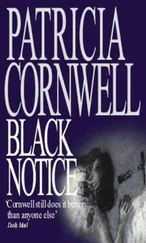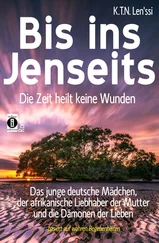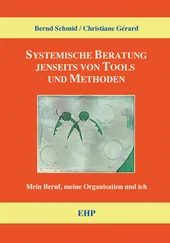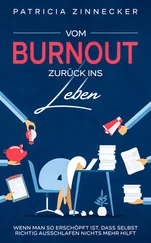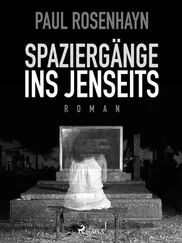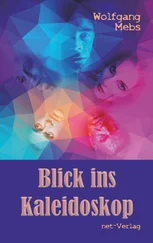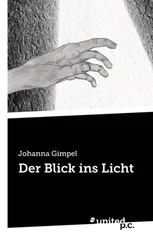Ende der 1990er-Jahre stellte der Palliativ-Mediziner Michael Barbato einen Fragebogen für die Angehörigen von Sterbepatienten zusammen. Er hatte erkannt, dass weder in seiner Klinik noch in den meisten anderen Hospiz-Einrichtungen je wirklich untersucht worden war, wie verbreitet solche Erfahrungen sind. Zu seiner Überraschung berichteten 49 Prozent der Befragten von ungewöhnlichen Erfahrungen, die sich nicht so einfach wegdiskutieren ließen. »Selbst wenn wir nicht verstehen, wie diese Phänomene entstehen«, schrieb er in seinem Artikel darüber, »legt die Fülle der Berichte doch nahe, dass wir sie nicht länger ignorieren können.« Und ganz sicher kann man sie nicht ignorieren, wenn sie einem selbst widerfahren.
Verluste tun weh. Und in unserer Kultur kommt dann noch der Schmerz des Schweigens dazu, aus Angst, abgewiesen oder lächerlich gemacht zu werden, wenn mit dem Verlust etwas unerwartet Wundersames einherging. Erzählen Sie jemandem, Ihre Schwester habe in der Nacht, als Ihr Vater starb, eine Erscheinung gehabt, und sofort erhalten Sie Erklärungen. Halluzinationen. Wunschdenken. Zufall. Und dahinter das Urteil: Na ja, Sie sind ja ganz schön leichtgläubig .
Auf einer Weihnachtsfeier mit alten Studienfreunden unterhielt ich mich mit einem Mann, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte und der jetzt in der IT-Abteilung einer Bank arbeitete. Ich erzählte ihm von dem Verlust von Katharine und meinem Vater und ein bisschen von dem, was dabei geschah, worauf er freundlich erwiderte: »Ich will dir nicht zu nahe treten, aber deine Schwester hat sich das mit Sicherheit einfach eingebildet.«
Auf dem Heimweg fragte ich mich, warum ihm wohl wichtig war, das zu sagen. Soweit ich wusste, hatte er sich nie ernsthaft mit Psychologie beschäftigt, ganz zu schweigen von Sterbebegleitung, und doch maßte er sich die Autorität an, beurteilen zu können, was Sterbende sehen. Genauer gesagt, hatte er einem der heiligsten Momente von Katharines Leben den Sinn abgesprochen. Einfach so. Wäre dieser IT-Spezialist einer Bank wohl aufgesprungen, als meine Schwester bei der Trauerfeier meines Vater sprach, um zu sagen: »Entschuldigen Sie bitte! Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber …«?
Als meine Wut nachließ, fragte ich mich, wie er sich wohl seine Tage wegerklärte. Wir sind sinnsuchende Wesen. Wir leben inmitten von Geschichten und Mythen, und es bekommt uns nicht gut, an ein materialistisches Weltbild gekettet zu sein und obendrein als Narren hingestellt zu werden, wenn wir trauern.
Ich liebe dich, flüstert der Bräutigam seiner Braut vor dem Altar zu. Eine Wissenschaftlerin springt auf und fordert: Beweise es! Beweise, dass du deine Frau liebst! Hast du ein MRT?
Beweise deinen Ärger, beweise dein Mitgefühl, beweise deinen Humor – keiner fordert von uns, diese Dinge zu beweisen, denn Liebe, Ärger, Mitgefühl und Humor gelten allgemein als Teile des menschlichen Wesens, selbst wenn sie abgesehen von gewissen neuronalen Verortungen nicht weiter messbar sind.
Einst galt auch Spiritualität als selbstverständlicher Bestandteil der menschlichen Erfahrung, doch heutzutage gilt sie als besonderer Zustand, der besondere Beweise erfordert. Warum? Es hat nichts damit zu tun, was sich beweisen oder nicht beweisen lässt.
Von den 1979 in einer Studie befragten über 1000 US-amerikanischen College-Professoren erklärten 55 Prozent der Naturwissenschaftler, 66 Prozent der Sozialwissenschaftler und 77 Prozent der Geisteswissenschaftler, gewisse Formen übersinnlicher Wahrnehmung entweder als Tatsache oder zumindest als ziemlich wahrscheinlich zu betrachten. Nur 2 Prozent hielten es für absolut unmöglich. Dies war jedoch vor dem Aufschwung der biologischen Psychiatrie in den 1990er- und 2000er-Jahren, in dem sich die Annahme vertiefte, jede menschliche Erfahrung könne durch Gehirnfunktionen erklärt werden.
Der Psychologe Charles Tart betrieb 1999 eine Internetseite namens »Archives of Scientists’ Transcendent Experiences«, um Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, ihre ungewöhnlichen oder spirituellen Erfahrungen anonym mitteilen zu können, ohne um ihre Karriere fürchten zu müssen. Tart bezeichnete es tatsächlich als einen »geschützten Raum«, als ginge es darum, Alkoholexzesse oder das heimliche Tragen von Damenunterwäsche zuzugeben. Ingenieure, Chemiker, Mathematiker, Biologen – alle Fakultäten posteten Beiträge. Diese und viele andere Wissenschaftler straften die gängige Meinung Lügen, nur leichtgläubige, sentimentale Menschen hätten Erscheinungen. Eine neuere Studie des British Journal of Psychology 1wies nach, dass sich die intellektuelle Kapazität von jenen, die ungewöhnliche Erfahrungen machen, und jenen, die sich als Skeptiker bezeichnen, nicht unterscheidet; andere Studien bestätigen das.
Der Princeton-Physiker Freeman Dyson schrieb 2007:
Jeder, der wie ich glaubt, dass es außersinnliche Wahrnehmungen gibt, die nicht wissenschaftlich erfassbar sind, muss die Möglichkeiten der Wissenschaft für begrenzt halten. Ich stelle die Arbeitshypothese auf, dass außersinnliche Wahrnehmungen real sind, jedoch zu einem mentalen Universum gehören, welches für die rigiden Strukturen wissenschaftlicher Beweisführungen zu fließend und zu flüchtig ist.
Die Instrumente, mit denen wir das Genom kartiert und die Wachstumsfaktoren von Weizen bestimmt haben, sind hier nicht anwendbar. Die paranormale oder spirituelle Erfahrung entsteht unaufgefordert. Wir könnten meine Schwester nicht in ein Labor stecken, und mein Vater könnte nicht wiederholt sterben.
Dyson bekam für sein Vorpreschen viel Prügel, doch wie viele von uns kannte er unerklärliche Phänomene aus seiner eigenen Familie. Seine Großmutter sei eine »notorische und erfolgreiche Gesundbeterin« gewesen, schreibt er. Und einer seiner Cousins war lange Herausgeber des Journal for the Society of Psychical Research . Skeptiker warnen, solche Menschen seien Meistertäuscher oder deren leichtgläubige Opfer, und wahrscheinlich trifft das auch auf ein paar von ihnen zu. Doch wenn man Menschen kennt, deren Intelligenz und Vernunft man schätzt; wenn man merkt, wie sie selbst damit ringen, auf so ungewöhnliche Weise Dinge zu erleben, dann sind solche Schubladen untauglich. Wie Dyson über seinen Cousin und seine Großmutter sagt: »Sie waren beide keine Narren.« Auch all die Menschen, die sich mir anvertrauten, waren keine Narren. Auch meine Schwester nicht.
Solche persönlichen Momente der Bekehrung – von der Annahme eines bestimmten Regelwerks, auf welchem die Welt beruht, zu der Vermutung, es könnten noch ganz andere Kräfte am Werk sein – können Menschen »wie ein Schock« treffen, wie es Elizabeth Lloyd Mayer, Psychiaterin an der University of California, nach einer Erfahrung beschrieb, in der unbekannte Sinneseindrücke mitspielten. In ihrem Fall entstand dieser Schock durch Hellsehen, das heißt durch die Fähigkeit, über Entfernungen hinweg Informationen zu gewinnen. 1991 war die seltene und kostbare Harfe von Mayers Tochter gestohlen worden, und keine öffentlichen Aufrufe oder polizeilichen Ermittlungen ergaben irgendwelche Hinweise. Nach einigen Monaten schlug ihr eine Freundin vor, einen Rutengänger zu konsultieren – sie habe ja schließlich nichts zu verlieren. »Verlorene Gegenstände mit gegabelten Stöcken wiederfinden?« Mayer war höchst skeptisch. Doch ihre Freundin gab ihr die Telefonnummer des Vorsitzenden der Amerikanischen Rutengänger-Gesellschaft, eines Mannes namens Harold McCoy aus Arkansas.
»Ich rief ihn noch am selben Tag an. Harold ging direkt dran – freundlich, fröhlich, starker Arkansas-Akzent.« Sie erklärte ihm, sie suche in Oakland, Kalifornien, nach einer gestohlenen Harfe, und fragte zweifelnd, ob er ihr helfen könne, sie wiederzufinden. »Warten Sie einen Moment«, sagte er, »ich sage Ihnen gleich, ob sie noch in Oakland ist.« Er hielt kurz inne und meinte dann: »Nun, sie ist noch da. Schicken Sie mir eine Straßenkarte von Oakland, dann kann ich die Harfe für Sie lokalisieren.« Mayer schickte ihm die Karte per Eilboten. Zwei Tage später rief McCoy sie an und sagte ihr genau, in welchem Haus die Harfe ihrer Tochter sei.
Читать дальше