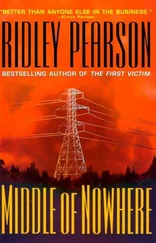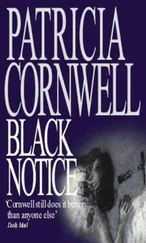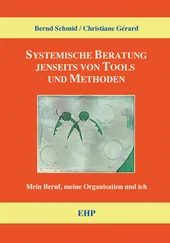Wir könnten sagen: Nun, sie hat vielleicht vergessen, dass sie stirbt . Aber dem war nicht so.
»Ist mit Mum alles in Ordnung?«, fragte sie mich manchmal besorgt. Oder: »Ich glaube, ihr löst euch noch schneller auf als ich.«
Und das war auch so. Mein Gehirn war ein zusammenbrechender Computer, ein Auto im Leerlauf, ein alter, rauschender Schwarz-Weiß-Fernseher. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, denn ich konnte meine eigene Auflösung nicht mehr intellektuell beobachten. Ich war verloren, aber Katharine war es nicht. Sie wusste sehr wohl, dass sie im Sterben lag, und sie wusste noch mehr. Achtundvierzig Stunden vor ihrem Tod sagte sie uns, sie sei jetzt auf dem Weg. Ganz wörtlich, im Sinne von: »Ich gehe jetzt.« Wie wusste sie das? Die Zeit im Hospiz hätte zwei Monate, sechs Monate oder zwei Jahre dauern können. Schon allein die Hoffnung hätte sie zu solch einer Sicht bewegen können; die ersten elf Monate ihrer Krankheit hatte sie von Hoffnung gelebt.
Einer Harvard-Studie zufolge überschätzen 63 Prozent der Ärzte die restliche Lebenszeit ihrer unheilbar kranken Patienten erheblich. Die Patienten selbst werden zum Ende hin oft äußert präzise. Manche wissen den Zeitpunkt ihres Ablebens bis auf die Stunde genau.
Eines Morgens wachte Katharine auf und sagte mit klarer Stimme ratlos zu Joel, der zerzaust neben ihr auf dem Krankenbett lag: »Ich weiß nicht, wie ich gehen kann.« Als wolle sie etwas Schwieriges lernen, wie Wasserski fahren oder Brotteig herstellen. Offenbar fühlte sie nicht mehr wie wir in unserer hungrigen, begeisterten Freude, sie noch lebendig anzutreffen, wenn wir jeden Tag an ihre Seite eilten. Sie zog Joel damit auf, er sähe in seiner hohläugigen Aufgewühltheit aus wie ein Drogenabhängiger. Sie blieb präsent, aber sie war auch woanders. Katharine hatte sich auf eine neue Ebene des Bewusstseins begeben, auf die wir ihr nicht mehr folgen konnten.
An jenem Nachmittag schaute sie lange durch die Terrassentüren, mit einem Blick, der mir, die ich neben ihr saß und ihre Hand streichelte, etwas entnervt erschien. Verärgert.
»Was siehst du?«, fragte ich sie.
Sie hob schwach den Arm und wies in Richtung des Gartens: »Nutzlose Flugbegleiter.«
Wir lachten alle überrascht. In diesem Moment kam eine Hospiz-Helferin mit einem Wagen mit Kaffeegebäck herein.
Katharine wandte sich aufmerksam der neuen Besucherin zu und fragte: »Wie ist die Lage?«
Die Helferin antwortete mit fröhlicher Stimme: »Nun, die Lage ist so, dass wir Zitronentörtchen, Schokocreme-Schnitten und Haferkekse haben. Alles selbst gebacken.« Sie schien mit ihrem Angebot zufrieden.
Meine Schwester sah sie an, als sei sie übergeschnappt.
»Ich meine«, Katharine räusperte sich, denn ihre Lungen fingen an, sich mit Wasser zu füllen, »wann gehe ich?«
Joel unterdrückte meisterhaft seinen rasenden Schmerz darüber, nach nur drei gemeinsamen Jahren die Liebe seines Lebens zu verlieren, und antwortete mit indischem Akzent (sie hatten sich in Neu-Delhi kennengelernt) und wackelndem Kopf: »Das entscheidet ihr, du und Gott.«
Katharine ging in der darauffolgenden Nacht, in Stille und bei Kerzenlicht, während meine Wange auf ihrer Brust und meine Hand auf ihrem Herzen lagen. Ich spürte, wie ihr Atem langsamer wurde und nachließ wie die Wellen der auslaufenden Gezeiten. Joel saß auf der einen Seite des Bettes, meine Schwester Annie auf der anderen. Die Schwester kam barfuß und mit Taschenlampe herein, um den Tod mit einem wortlosen Nicken zu bestätigen, und wir salbten Katharines Körper mit Öl und wickelten sie in Seide. Die Hospiz-Mitarbeiter stellten eine brennende Kerze ins Fenster.
Meine Mutter und Katharines Patin Robin im fast 5000 Kilometer westlich gelegenen Vancouver erwachten aus dem Schlaf, als hätte die Zeit plötzlich einen anderen Klang. Die ganze Welt sollte um den Verlust solch eines wundervollen Mädchens trauern, ging es Robin noch halb im Traum durch den Sinn, als die Vorhänge im ersten Morgenlicht raschelten.
Ich erinnere mich daran, wie ich mein Gesicht in den Wind hielt nach Katharines Tod, wie ich die Luft spürte, die Kälte und die Flüchtigkeit, die Dringlichkeit. Jeden Tag Wind im Gesicht, meine Aufmerksamkeit auf völlig neue Weise wiederfindend. Ich war mir des Atems bewusst, dessen, was die alten Griechen Pneuma nannten, einer beseelten Welt. Ich schlang die Luft in mich hinein.
»Willkommen in unserer Gemeinschaft«, sagte in jenem Sommer jemand mit freundlicher Ironie zu mir und bezog sich damit auf diesen verrückten Perspektivwechsel, der mit der Trauer einhergeht, und genauso fühlte es sich an. Plötzlich waren da Menschen, die verstanden, wie man sich fühlt, wenn man ständig nach Luft schnappt. Es stellte eine unglaublich starke Verbindung her; selbst wenn wir nichts anderes gemeinsam hatten, war uns jetzt der Tod gemeinsam. Ich kann mir gut vorstellen, wie dies vor zwei- oder fünfhundert Jahren, als der Tod und seine Rituale eine Gemeinschaftsangelegenheit waren, eine Grundlage für Stammeszugehörigkeit bildete. Heute scheint es in so vieler Hinsicht tabuisiert. Die Erfahrung der Trauer ist gesellschaftlich zerbrochen. Wir können einander keine allgemein stimmigen Beileidsbezeugungen wie »Dein Vater und deine Schwester sind jetzt bei Gott« anbieten. Die Leute fühlen sich verunsichert und unwohl um einen herum, und jene, die wissen, wie unsere Welt aus den Angeln gehoben wurde, sagen Dinge wie: »Ja, meine Liebe, ich weiß.« Alles fühlt sich seltsam an. Wir reagieren auf andere Zeitklänge, wir ringen um Luft.
Denn eine Untereinheit – ungefähr die Hälfte der Mitglieder dieses Volkes – ist noch durch ein weiteres, noch leiseres, fast unsichtbares Element miteinander verbunden: das Gefühl, einem fundamentalen Mysterium begegnet zu sein. Wir haben von den Sterbenden gelernt, dass es Kommunikationskanäle gibt, derer wir uns vorher nicht bewusst waren, unbekannte oder lang vergessene Pfade, über die wir Dinge auf geheimnisvolle Weise wissen und uns auf geheimnisvolle Weise miteinander verbinden können, auch mit den Sterbenden und Toten.
Der Eindruck, die Toten könnten uns eine Tür öffnen, die irgendwo hinführt, entstand zunächst durch leise anvertraute Geschichten. Im Sommer und Herbst 2008 begannen die Leute, mir Dinge zu erzählen – Freunde und Bekannte, die ich seit Jahren kannte, aber auch Fremde, die im Flugzeug neben mir saßen oder mit denen ich in einer Bar ins Gespräch kam. Wenn ich ihnen erzählte, was ich mit meinem Vater und meiner Schwester erlebt hatte, antworteten sie mit eigenen Erfahrungen. Meistens begannen sie mit Bemerkungen wie: »Ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber …«, oder: »Wir haben da immer nur in der Familie drüber gesprochen, aber wenn Sie das Thema erforschen möchten …«, worauf außergewöhnliche Geschichten über Visionen auf dem Sterbebett, Nahtoderfahrungen und plötzliche Erscheinungen von Sterbenden oder nahestehenden Menschen in Gefahr folgten. Es waren alles kluge, vernünftige Menschen. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass es überall um mich herum diese unterirdische Welt gab.
Der Direktor eines großen Musikunternehmens fuhr mich eines Abends nach einem Geschäftsessen nach Hause. Als ich ihm erzählte, ich würde erwägen, über die Dinge zu schreiben, die in meiner Familie vorgefallen waren, parkte er den Wagen vor meinem Haus, ohne Anstalten zu machen, sich zu verabschieden. Er erzählte mir, er sei als Junge eines Morgens zum Frühstück heruntergekommen und habe seinen Vater wie immer am Frühstückstisch sitzen sehen. Als ihm seine Mutter dann mitteilte, sein Vater sei in der Nacht verstorben, fragte er sich kurz, ob sie verrückt geworden sei. »Er sitzt doch da«, hatte er gesagt. Es war der erstaunlichste und beunruhigendste Moment seines Lebens gewesen.
An einem heißen Sommernachmittag stand ich auf einem Gehweg in Pittsburgh und plauderte mit einer Frau. Wir befanden uns auf einem Wochenendausflug zu den Carnegie- und Warhol-Museen und warteten auf unsere Mitreisenden. Ich erzählte, was mir wiederfahren war, und sie nickte und berichtete von ihrer Schwester, die eines Nachts mit dem Gefühl erwachte, überall auf ihrem Bett sei zersplittertes Glas, als wäre das Schlafzimmerfenster nach innen zerborsten. Unter dem Eindruck des Adrenalinschubs sprang sie aus dem Bett und tastete vorsichtig nach den Glasscherben, die sie auf ihrer Bettdecke vermutete, doch da war nichts. Das Fenster war intakt, alles war still. Am nächsten Tag erfuhr sie, dass ihre Tochter einen Autounfall gehabt hatte, bei dem die Windschutzscheibe zertrümmert worden war. Wir sprachen noch ein wenig, auch über einen anderen Todesfall in ihrer Familie, und als die anderen Touristen zu uns stießen, standen ihr die Tränen in den Augen. Es berührt mich immer wieder, wie stark und unmittelbar unsere Erfahrungen mit dem Tod sind, wie sorgfältig wir sie verborgen halten und wie dicht unter der Oberfläche sie doch liegen.
Читать дальше