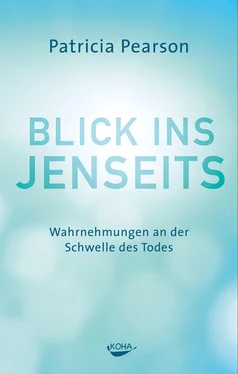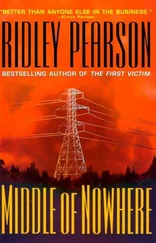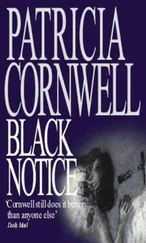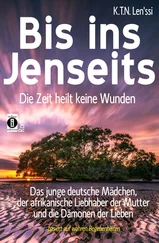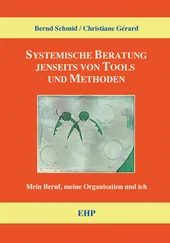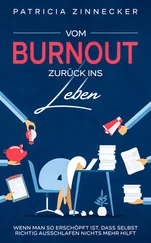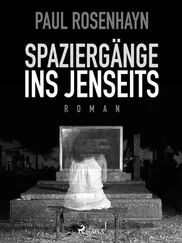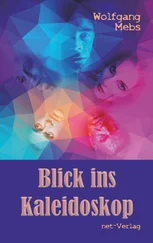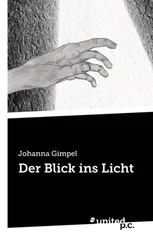»Keiner hat die Welt wirklich gesehen«, schrieb der Metaphysiker Gaston Bachelard, »wenn er nicht geträumt hat, was er sieht.« Vater tot und Schwester sterbend. Zeit, Bedeutung und Spiritualität willkommen zu heißen, auch wenn sich der Arzt gerade über die Wirksamkeit der letzten Chemo-Runde auslässt.
Wir kletterten wieder aus dem Canyon, oft innehaltend, um aus den transparenten Plastikschläuchen unserer neumodischen Rucksäcke Wasser zu trinken. Als wir den Rand des Canyons erreichten, sah ich einen Regenbogen. Mitten im Wüstenhimmel hing ein perfekter, strahlender kleiner Regenbogen, als hätte ein Kind einen Aufkleber an einem Fenster angebracht. Angesichts des trockenen Klimas schien das so merkwürdig, dass ich bewusst auf die Uhr schaute. Kurz vor Mittag.
Am Abend versank die Sonne mit einem atemberaubenden, alles überströmenden Licht im Canyon. Von meinem Liegestuhl auf der Veranda der El Tovar Lodge aus rief ich Katharine in Montreal an. Keine Antwort.
»Kitta-Kat«, sprach ich auf den Anrufbeantworter, »ich sitze hier am Rand des Grand Canyons.« Am Ende der Welt, im Zusammenströmen von Schönheit und Schrecken, hier für dich, hier ohne dich. »Ich denke die ganze Zeit an dich.«
Sie antwortete nicht, meine Schwester. In der Stunde, in der ich am Wüstenhimmel den Regenbogen gesehen hatte, kurz vor Mittag, war sie mit akuter Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden, und die Ärzte hatten sie gedrängt, eine Patientenverfügung zu kritzeln.
Eine Woche später lag ich innig verschränkt mit ihr auf ihrem schmalen Krankenhausbett in Montreals Royal Victoria Hospital und sah in ihrer kleinen, mit einem Vorhang abgetrennten Nische mit ihr zusammen fern. Glatzköpfig aus ihrem Klinikhemdchen hervorschauend, schlürfte sie durch einen Strohhalm Pepsi, die Hand voller blauer Flecke von all den IV-Zugängen, die Beine zu blass und dünn. Mein Gesicht war noch von der Sonne Arizonas gebräunt, während meine schöne Schwester von Steroiden aufgequollen und von der langsam zurückgehenden Blutinfektion gerötet neben mir lag. Sie bekam endlich Morphium, und zum ersten Mal, seit sie hier war, zeigte sich in ihren Mundwinkeln ein kleines Lächeln. Sie hatte die ganze Woche unter Wellen heftigster Kopfschmerzen gelitten. In der Klinik hatten sie ihr nichts als Tylenol angeboten, weil sie sie auf die Infektion hin therapierten und es keine Kommunikation mit dem Team gab, welches sie gegen den Krebs behandelte. Aufgrund von Katharines üblicher Anmut und Gefasstheit hatten die Ärzte und Schwestern auf ihrer Station nicht gemerkt, wie sehr sie litt, bis ich um drei Uhr morgens schließlich einen tasmanischen Teufels-Wutanfall hinlegte und drohte – ich bin nicht stolz darauf –, der Stationsschwester das Bein abzusägen und ihr dann Tylenol anzubieten, wenn sie nicht aufhörte, dies als das Einzige zu bezeichnen, was für Mrs. Pearson »erlaubt« sei.
Da waren wir also, meine Schwester und ich, Händchen haltend auf ihrem Bett, und schauten uns Berichte über die amerikanischen Vorwahlen an, als ihr Onkologe hereinkam, der endlich mitbekommen hatte, dass sie auf dieser Station lag und auf Blutvergiftung behandelt wurde. Er verkündete, sie würde nun in die Palliativ-Abteilung verlegt. Keine Chemo mehr. Keine Bestrahlung. Die Waffen sollten ruhen. Jetzt ginge es, seinen Worten gemäß, darum, »die Symptome unter Kontrolle zu behalten«.
Am 14. Mai 2008 kam Katharine ins Hospiz. Der Arzt der Palliativ-Abteilung meinte, es könne sich höchstens noch um Wochen handeln, aber niemand sagte es ihr. Sie konnte sich weiter einen endlosen Horizont vorstellen, fern oder nah, hell oder dunkel. Sie fragte nicht. Sie wurde stattdessen zu einer friedvollen Königin, die ihrem Hofstaat von fünfzig oder mehr Freunden, Verwandten und Kollegen vorsaß, die alle für ein letztes Gespräch, einen letzten Kuss vorbeikamen. Über den kurzen Flur des Hospizes ergoss sich ein Strom von weinenden Managern in schicken Anzügen und gut betuchten Frauen mit rot geränderten Augen und Veuve-Clicquot-Flaschen im Arm. Nur noch einmal anstoßen, noch einmal miteinander lachen.
Die Hospiz-Schwestern erzählten mir später, wie sie das beeindruckt hatte. Sie waren mehr an kleine Familiengruppen gewöhnt, die in Stille ab und an ältere Patienten besuchten. Sie sahen uns Champagnerflaschen köpfen, während wir Katharines Lieblingssongs spielten und sie sich tanzend in ihrem Bett wiegte. Wir brachten ihr alle Nahrungsmittel, nach denen sie ein flüchtiges Verlangen äußerte, und Maiglöckchen, um ihre Nase in ihnen zu versenken. Nie habe ich Menschen erlebt, die so herrlich emotional aufeinander eingeschwungen waren wie wir damals im Mai, als meine Schwester im Sterben lag. Wenn sie mehr Energie wollte, drehten wir auf, wenn sie weniger wollte, schraubten wir die Energie runter. Die Abstimmung war so fein, dass wir Besucher, die wohlmeinend, aber in der unpassenden Energie hereinkamen, wie eine Rugbymannschaft aus dem Feld drängten. Bitte raus, raus! Ihr seid zu plapperig/zu traurig/zu dominant/zu sehr im Machbarkeitswahn .
Wenn ich meine Schwester auf die Wange küsste, küsste sie mich zurück und betrachtete mich auf so liebevolle Art, dass es mich verblüffte. Großzügige Liebe, freigesetzt durch Bedürftigkeit. Oft saßen wir wortlos beisammen, während sie schlief – meine anderen beiden Schwestern, mein Bruder und ich. Manchmal massierten wir ihr die Hände mit Creme und sangen leise für sie. Ihr Liebster, Joel, spielte auf seiner Gitarre. Meine von zwei Trauerwellen erschütterte Mutter las ihr die Liebesgedichte vor, die unser Vater Anfang der 1950er für sie verfasst hatte.
Eines Nachmittags kam Katharines Exmann mit einem riesigen Strauß Frühlingsblumen, die, wie er erklärte, anonym auf ihrer ehemals gemeinsamen Türschwelle hinterlegt worden seien. »Alle aus der Nachbarschaft lieben dich, Katharine«, erklärte er mit ernstem Nachdruck.
»Es gibt bestimmt auch jemanden, der mich nicht liebt«, erwiderte sie trocken-amüsiert. Sie sprach nur noch wenig in jenen letzten zehn Tagen ihres Lebens. Hier und da ein paar Sätze, oft nur ein, zwei Worte. Doch aus allem, was sie sagte, ging hervor, dass sie präsent war und alles mitbekam. Deshalb fanden wir es umso bemerkenswerter, dass sie so zufrieden schien. Sie genoss unsere Gesellschaft und die Musik, die wir spielten, und betrachtete bewundernd den Garten hinter ihrem Fenster und das Lichtspiel in den Vorhängen.
»Wow, das war seltsam«, sagte sie einmal, als sie mit einem entzückten Lächeln erwachte. »Ich habe geträumt, ganz von Blumen eingehüllt zu sein.«
Alles erschien ihr interessant – interessant und zusagend, als befände sie sich in einem unbekannten, angenehmen Abenteuer. Sie sah großartig aus, als würde sie von innen leuchten. Manchmal unterhielt sie sich flüsternd mit Personen, die ich nicht sehen konnte. Zu anderen Zeiten starrte sie an die Zimmerdecke und zeigte eine Fülle von Ausdrücken im Gesicht – verwirrt, amüsiert, skeptisch, überrascht, beruhigt – wie eine Zuschauerin, die in einem Planetarium eine himmlische Lichtshow genießt.
Ich betrachtete sie sehnsüchtig fragend, aber sie konnte es mir nicht übersetzen. Meine Schwester, mit der ich jedes Geheimnis geteilt hatte, befand sich bereits jenseits der Worte. »Es ist so interessant«, begann sie eines Morgens und fand dann keine Worte mehr.
»Es muss echt frustrierend sein, es nicht ausdrücken zu können«, sagte ich leise, und sie nickte. Wir legten die Stirn aneinander.
Ich konnte nur anhand der Berichte anderer raten oder ahnen, was sie erlebte, anderer, die ihre Stimme wiedergefunden hatten. Später las ich beispielsweise, was der Schweizer Genealoge Albert Heim 1892 geschrieben hatte, nachdem er von einem Berg gestürzt war: »Da war kein Kummer, auch keine lähmende Furcht. Keine Sorge, keine Spur von Verzweiflung oder Schmerz. Eher ein ruhiger Ernst, tiefe Akzeptanz und eine deutliche geistige Lebendigkeit.«
Читать дальше