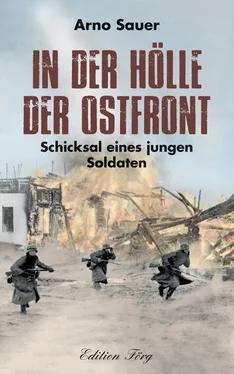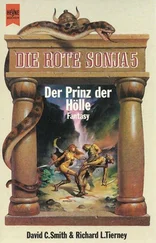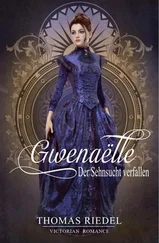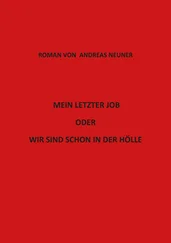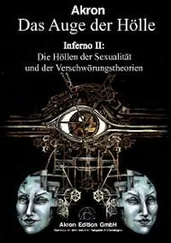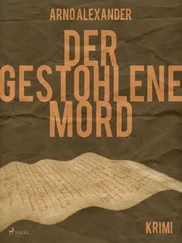Unser Kamerad Franz Färber nutzte seine freie Zeit in anderer Art und Weise. Er war ein wirklich begnadeter Hobbymaler und wusste Gesichter ausgesprochen naturgetreu wiederzugeben. So zeichnete er einige von uns in Form einfacher Bleistiftskizzen. Das lange Stillhalten musste ich ertragen, und mein Porträt entstand in zwei Sitzungen mit ausgiebiger Zigarettenpause.
Am 22. Juni 1941 begann unter dem Decknamen Unternehmen »Barbarossa«, benannt nach dem deutschen Kaiser Friedrich I. Barbarossa, der Angriff der deutschen Wehrmacht auf Russland. Die Operation erfolgte von Ostpreußen im Norden bis in die Karpaten im Süden mit drei Heeresgruppen, zwei Luftflotten und 2,5 Millionen Soldaten.
Wir erfuhren es durch unsere Ausbilder im Unterrichtsraum und reagierten mit betroffenem Schweigen. Es gab keine Freudenbekundungen und keine »Hurra«-Rufe, hatten wir doch nicht damit gerechnet, dass die militärische Führung den bereits bestehenden zahlreichen Kriegsschauplätzen einen weiteren hinzufügen würde. Was würde das für uns bedeuten? Warum musste das sein? Welchem Zweck sollte dieses waghalsige, gar wahnwitzige Abenteuer dienen? Wir konnten uns keinen Reim darauf machen, nicht mit 17 Jahren hier im RAD Lager unweit der luxemburgischen Grenze. Diese äußerst bedenkliche Neuigkeit konnten wir nur stillschweigend zur Kenntnis nehmen. Aber wir spürten, dass dieser Gegner in einer anderen Liga spielte als wir es bisher kannten, dass etwas sehr Bedrohliches auf uns zukam. Wir verfolgten in den nächsten Tagen und Wochen wie gebannt die von Euphorie und Siegeszuversicht getragenen Meldungen im Rundfunk und in der Presse. Die Siegesmeldungen überschlugen sich.
Als der deutsche Angriff im Herbstschlamm erstmals ins Stocken geriet und durch den besonders frühen und starken Wintereinbruch einige Wochen später kurz vor Moskau schließlich ganz zum Erliegen kam, erhielten wir nach acht Monaten Dienstzeit im RAD kurz vor Weihnachten zehn Tage Urlaub. Auf diesen Tag hatten wir alle seit Langem sehnsüchtig gewartet, und ich kann es gar nicht beschreiben, welche Glücksgefühle in uns aufstiegen, als wir in Irrel den Zug bestiegen, um zum ersten Mal nach so langer Zeit nach Hause zu fahren. Die wenigen Briefe, die ich von Mutter erhielt, konnten mir mein Heimweh nicht nehmen und die Heimat nicht ersetzen. Jetzt war es endlich so weit, endlich!
Paul und ich wollten natürlich zusammen im gleichen Zug fahren und wählten die Verbindung über Trier-Ehrang, anschließend über Wittlich und dann entlang der lieblichen Mosel, vorbei an Cochem bis Koblenz. Der Winter hatte die Landschaft komplett mit Schnee bedeckt, und wir genossen die vorbeiziehende romantische Winterlandschaft des Moseltales in einem beheizten 2. Klasse-Waggon.
Es war bereits die dritte Kriegsweihnacht, und entsprechend mager fielen auch die Geschenke aus. Apfelsinen und andere Südfrüchte gab es schon lange nicht mehr, und Kaffee, Mehl, Zucker und auch Schuhe sowie vieles mehr bezog man bereits rationiert über Lebensmittelmarken. Es ging ruhig zu in unserem tief verschneiten Dorf. Das Leben im Ort schien still zu stehen. Arbeiten im Freien konnten wegen der extrem kalten Witterung und des starken Schneefalls nicht verrichtet werden. Private Autos gab es nicht mehr, und so fuhren auch keine über die Reichsstraße. Kleinere Kinder freuten sich auf das Schlittenfahren. Wir aber waren mit dem 17. Lebensjahr schlagartig keine Kinder mehr.
Wir hatten viel Zeit zum Nachdenken, und meine Gedanken schweiften oft in meine Kinder- und Jugendzeit ab.
Fünf Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde ich als dritter Sohn der Bäuerin Antoinette Sauer (geborene Quirbach, 1883) und des Landwirts und Kartoffelhändlers Josef Sauer, am 22. Dezember 1923 in Bassenheim bei Koblenz im Rheinland geboren und in der katholischen Pfarrkirche St. Martin auf den Namen Friedrich Gottfried getauft.
Der Name Gottfried stammte von meinem Patenonkel, einem Bruder meiner Mutter. Seitdem ich zurückdenken kann, wurde der Name Friedrich eigentlich nie ausgesprochen, sondern ich war ausschließlich der Fritz, oder »dat Fritzje«, wie man hier im moselfränkischen Dialekt sagt.
Mein ältester Bruder Hans, richtig mein Halbbruder, war Jahrgang 1908 und lebte mit meiner Mutter zehn Jahre mehr schlecht als recht allein, einquartiert bei Mutters Bruder Onkel Johann, nachdem ein junger Mann aus dem vier Kilometer entfernten Saffig meine Mutter geschwängert und trotz Eheversprechen hatte sitzen lassen, um in die USA zu gehen.
Als mein Vater Josef Sauer (geb. 1880) nach vier Jahren Krieg an der Westfront 1918 mit drei Orden dekoriert, deren Bedeutung mir später leider nicht mehr bewusst war, unversehrt nach Hause kam, heiratete er alsbald meine Mutter und adoptierte den kleinen Hans. Er gab ihm nicht nur seinen Namen, sondern behandelte ihn stets wie seinen eigenen Sohn. Dabei wurde bereits sehr früh festgelegt, dass Hans als Erstgeborener, wie es im Rheinland, aber auch in den meisten Gegenden Deutschlands üblich war, später einmal unseren landwirtschaftlichen Betrieb weiterführen sollte.
Mein zweiter Bruder Peter wurde im November 1920 geboren, und im Mai 1925 brachte Mutter mit immerhin schon 42 Jahren meinen dritten Bruder Karl zur Welt. In unserem Dorf gab es viele Familien, die den gleichen Familiennamen führten wie wir, und sie alle bekamen bis auf wenige Ausnahmen nur männliche Nachkommen, sodass meine Eltern, die gern auch ein kleines Mädchen gehabt hätten, auch mit Blick auf das fortgeschrittene Alter meiner Mutter, beschlossen, keine weiteren Kinder in die Welt zu setzen. Dabei spielten natürlich auch wirtschaftliche Aspekte eine nicht unerhebliche Rolle. Nach dem verlorenen Krieg war es in den Jahren der Weimarer Republik, die geprägt waren von Inflation und Arbeitslosigkeit, vielen Menschen nicht möglich, eine große Familie auch nur ausreichend zu ernähren, geschweige denn, diese mit den Dingen auszustatten, die für eine normale Lebenshaltung erforderlich sind.
Bestanden die Familien nach der zweiten Reichsgründung 1871 im aufstrebenden Kaiserreich noch aus durchschnittlich sechs bis zwölf Kindern, sank dieser Wert nach dem Ersten Weltkrieg etwa auf die Hälfte, wobei der Geburtenrückgang zum Teil durch die geringere Kindersterblichkeit kompensiert wurde. Denn nicht nur die Medizin, sondern auch das Sozialsystem machten nach der Jahrhundertwende zum Teil revolutionäre Fortschritte. Vor allem besserten sich die hygienischen Verhältnisse, und damit sank auch die Zahl der Sterbefälle durch Infektionen drastisch.
Meine Eltern hatten beide je sieben Geschwister, was mir eine Riesenanzahl von Cousins und Cousinen bescherte, mit denen man natürlich schön spielen konnte. Eine besondere Ausnahme war hier wiederum Onkel Peter Paul, ein Bruder meines Vaters. Die Familie wohnte einige Häuser weiter ebenfalls in unserer Straße. Ihr zur gleichen Zeit und in identischer Größe gebautes Haus Nr. 12 beherbergte allerdings ein paar Seelen mehr. Hier gab es noch eine richtige Großfamilie mit elf Kindern, sechs Jungen und fünf Mädchen. So gab es in unserem Dorf neben Weihnachten, Fastnacht, Ostern und Kirmes auch zahlreiche kleinere Familienfeiern, die sich aber hinsichtlich des finanziellen und kulinarischen Aufwands in sehr bescheidenen Grenzen bewegten.
Überhaupt war in unserem Dorf dank der vielen Kinder auf den zumeist noch unbefestigten Straßen, in Gärten, Wiesen, Feldern oder in unserem schönen Wald immer etwas los. Und so zogen und stromerten wir, wenn Vater uns nicht gerade aufs Feld mitnahm, bereits vor unserer Einschulung in die Volksschule durch Dorf und Gemarkung, immer auf der Suche nach Entdeckungen, einer interessanten Abwechslung, nach Abenteuern oder auch nur nach irgendetwas Essbarem. Von Mai bis Oktober wussten wir stets, wo es die ersten Erdbeeren, Himbeeren und Kirschen bis hin zu den letzten Brombeeren, Pflaumen, Birnen, Nüssen und Äpfeln gab.
Читать дальше