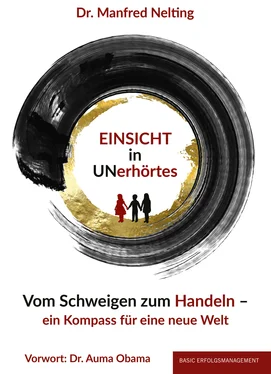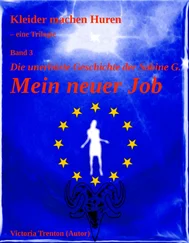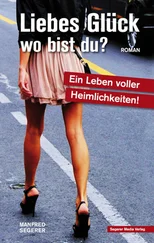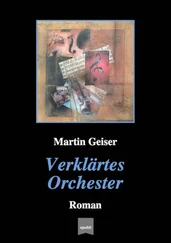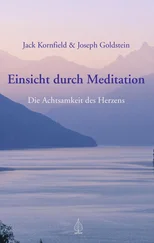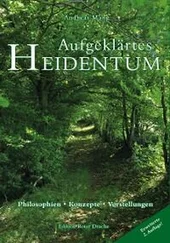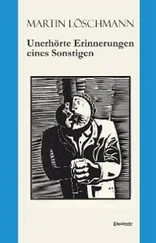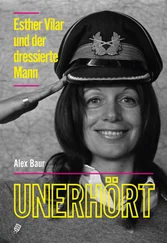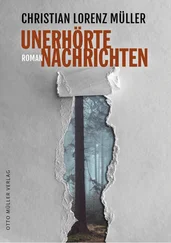Dies gilt es im Weiteren genauer zu besprechen. Das werde ich in Kapitel 4und 5machen. Dort soll auch das für die Corona-Krise wichtige Thema des Immunsystems angesprochen werden, das wir in der gesellschaftlichen Diskussion wieder aus der Vergessenheit herausholen wollen.
2.1.7 Stress durch sozialen Vergleich
Zufriedenheit und Glück durch Geld steigt im niedrigen Einkommensbereich an bis zu einer Höhe, in der die Grundbedürfnisse von Miete, Mobilität, Ernährung und einem üblichen Equipment im Haushalt und von Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, Kühlschrank, Fernseher usw. erfüllt sind.
Danach steigt die Zufriedenheit nicht weiter an mit steigendem Einkommen, ja man beobachtet vielfach eine zunehmende Unzufriedenheit bis hin zum Stress, weil man anfängt, sich in der Bevölkerung, in der Nachbarschaft bzw. unter Kollegen im Sozialrating zu verorten.
Der Mensch ist nicht in der Lage, eine universelle Bezugsgröße in sich zu fühlen, die ihn gänzlich unabhängig machen würde vor Vergleichen mit anderen Menschen. Man setzt sich also meist in einen konkreten Bezug zu Mitmenschen, verursacht also selbst ein Ranking, das einem guttut, wenn man darin gut abschneidet und einen verärgert bzw. sogar unter Stress setzen kann, wenn man darin schlecht oder ungenügend abschneidet oder immer in der unteren Skala verbleibt.
Das ist allerdings immer abhängig von kulturellen Einflüssen, also was jeweils als wichtig zu haben gilt, sowie von der Wirtschaftsform also, in welchem Ausmaß soziale Ungleichheit besteht und jeder mit jedem als Konkurrent gesehen und beurteilt wird. Weiterhin ist es wichtig, ob man mit dem jeweiligen sozialen Status gesehen wird oder eher nicht.
Viele versuchen, andere nach Möglichkeit irgendwie zu übertreffen, um sich im Ranking sichtbar zu halten oder zu steigen. Das geschieht meistens durch sichtbaren Konsum, also Werkzeug, Mode, Auto, was die Nachbarn oder die Kollegen mitbekommen können. Vieles „muss man einfach haben“, mit anderem „kann man gut punkten“. Das fängt schon im Kindergarten an und wird in der Schule sozusagen quasi zelebriert, was soziale Ungleichheit ausgesprochen fördert.
Die Werbung zeigt dabei in der Regel, wohin die Reise geht, man muss also auch schnell sein. Es kommt dabei nicht so sehr darauf an, ob man etwas braucht, sondern, wie man damit dasteht im Vergleich. Ich denke, jeder kann sich dabei erkennen, dass er oder sie aus solchen Gründen manchmal etwas kauft. Es ist uns bei unserer Art zu wirtschaften quasi von Kindesbeinen eingebläut worden, dass Besitz und Haben die soziale Stellung begründen, und besonders, wenn es sichtbar ist, uns als fortschrittlich, überlegen, vielleicht sogar als sexy auszeichnet. Nur so können wir Karriere machen und im Leben Erfolg haben, wird uns suggeriert.
So die Erziehung und die Werbung, aber es klappt dummerweise nicht immer und man kann auch keinen dauerhaft guten Zustand erreichen, sondern es droht ständig zu kippen, man muss also immer nachsteuern, soweit es der Geldbeutel zulässt. Das verursacht Stress und wenn wir darin stark verfangen sind, können wir allein dadurch gesundheitliche Probleme bekommen, also Stressfolge-Krankheiten.
Wie verhindert man diesen sinnlosen Konsum, was man nicht wirklich braucht und was zum Glücklichsein herzlich wenig beiträgt? Wir alle kennen ja die Halbwertzeit von zufriedenen Gefühlen über unsere Konsum-Beute, sie ist kurz.
Wir sind besonders anfällig dafür im Sinne einer Verführung (siehe auch Kapitel 4), wenn wir uns innerlich leer fühlen, wenn wir wenig Bestätigung bekommen oder bekommen haben, also wenig Selbstwert empfinden und nicht zu einer guten Selbststeuerung gelangen konnten. Diese Leere versuchen wir aufzufüllen, aber so, durch Konsum, klappt das nicht wirklich. Wir brauchen Zufriedenheit durch erfüllende Beziehungen, Begegnungen und Partnerschaft, Freude an unserer Arbeit und natürlich Anerkennung, aber nicht von irgendwem, sondern von Menschen, die uns nah und lieb sind. Dann kaufen wir viel eher nur das, was wir brauchen, garniert mit kleinen überschaubaren Lustkäufen als Belohnung für was auch immer.
Exkurs: Konsum als systemrelevant
Übermäßiger sozialer Vergleich ist ungesund, treibt aber den Konsum an und fördert den Wohlstand im systemischen Sinne. Konsum stabilisiert unseren Staat, in dem er in besonderer Weise der Wirtschaft ermöglicht zu wachsen. Konsum ist also in unserer Wirtschaftsweise im Grunde eine staatsbürgerliche Pflicht. Dies galt bisher meist, ohne dass dies so benannt wurde. Jetzt in der Corona-Krise drehte es sich nach dem Lockdown aber alles darum, den Konsum wieder anzukurbeln, um ein wirtschaftliches Zusammenbrechen bzw. eine schwere Rezession zu vermeiden. Dies wurde jetzt auch so ausgesprochen. Damit wurde offensichtlich, dass unser Wirtschaftssystem auf gefährliche Art und Weise verletzlich ist und Konsum systemrelevant. Ohne Konsum können wir diese Wachstumswirtschaft nicht retten, wie ungesund!
Wir kommen als Bürger hier in ein Dilemma: Zum einen haben wir die ethische Verpflichtung, besonnen zu konsumieren, um Ressourcen zu schonen und klimafreundlich zu handeln, zum anderen haben wir die moralische, offensichtlich staatsbürgerliche Pflicht zu konsumieren, damit unser Wirtschaftssystem nicht zusammenbricht.
Weiterhin werden wir implizit „gezwungen“, die Missachtung unseres Grundgesetzes durch unsere Wirtschaftsweise zu ignorieren mit der Folge, dass wir uns meist unbewusst aber doch im Hintergrund mitschuldig fühlen an den vom Staat zugelassenen massiven Rechtsbrüchen,
im Besonderen an GG § 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, § 2, Abs. 2. „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ und § 14, Abs 2 „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“
Wieso die Staatsmacht darin keine krasse Divergenz sieht, darüber mehr in Kapitel 4bei der Erörterung des sogenannten „freien“ Marktes.
Gleichzeitig wissen wir, dass ausufernder Konsum uns als Menschen nicht glücklich macht, müssen aber auch dieses ignorieren, um „den Wohlstand“ zu erhalten, der uns versprochen ist, und dürfen hier keine Gefährdung zulassen.
Das alles bedeutet eine innere Zerr-Spannung, sie setzt uns ungeheuer unter Druck, weil wir es nicht richtig machen können. Mit jeder Positionierung verstoßen wir gegen eine Pflicht. Das ist quasi wie ein unbewusstes, aber loderndes Feuer für unser Stress-System und fördert Gefühle der Ohnmacht.
So ein verletzliches System stützen zu müssen ist also an sich unerträglich. Aus der Sicht mündiger Bürger müssen wir dagegen sozialen Widerstand leisten, aber in der Form, dass wir an einer Umwandlung des Wirtschaftssystems arbeiten mit dem Ziel, dass es funktioniert, auch wenn wir nicht mehr sinnlos ausufernd konsumieren. Ein solches Wirtschaftssystem ist die Gemeinwohl-Ökonomie, in der die genannten Dilemmata aufgehoben sind. Wohlstand bedeutet hier genug zu haben, uns aber auch aus den inneren Zerr-Spannungen befreien zu können und gemeinsam mit unseren Mitmenschen zu kooperieren. Der soziale Vergleich ist vermutlich nicht gleich völlig aufgehoben, wird aber mäßiger und hat nicht mehr die Getriebenheit zum Konsum.
Die Gemeinwohl-Ökonomie und wie der Prozess der Umwandlung dorthin gelingen kann, beschreibe ich in Kapitel 5.
Exkurs Soziale Ungleichheit
Wir müssen dabei noch einen Blick auf die soziale Ungleichheit werfen, die noch stärker als der soziale Vergleich für die nachteilig Betroffenen eine Verletzung ihres Daseins bedeutet, besonders was Würde und Gesundheit angeht. Die Lebenserwartung sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen in Deutschland (definiert durch ein Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 60 % des gesellschaftlichen Mittelwertes) ist im Vergleich zu Beziehern hoher Einkommen um bis zu elf Jahre verringert, das Risiko für chronische Erkrankungen nach Daten des Robert-Koch-Instituts um das 2-3-fache erhöht (siehe auch Kapitel 5, S. 493). 6
Читать дальше