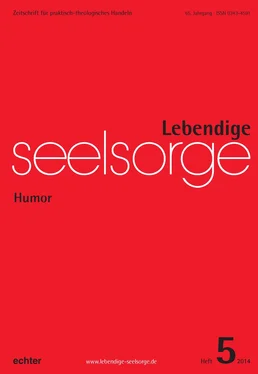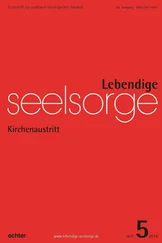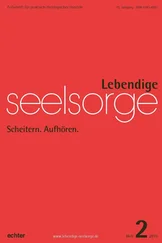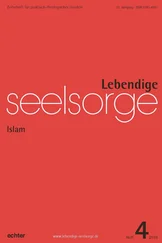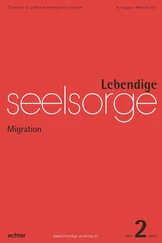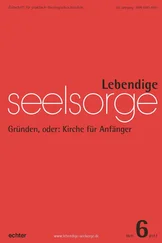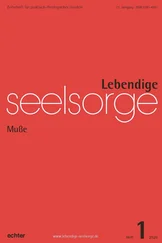Religion und Glauben haben nicht nur Regeln, sondern auch einen Witz, kann man in Abwandlung des Wittgenstein-Aphorismus sagen (vgl. Wittgenstein , § 564 und § 567). Um zu verstehen, muss man nicht nur auf, sondern auch zwischen den Zeilen lesen können. Darin besteht die Kunst der Kommunikation (vgl. Fresacher 2006). Sie lebt von Anspielungen und Leerstellen. Sinn und Bedeutungen stecken nicht im Text, sondern erschließen sich im Kontext, in dem der Text Imaginationen hervorruft – und möglicherweise ein unverhofftes Lachen (s. die Karikatur). In diesem semantischen Spannungsfeld lässt sich jede Äußerung wiederum auf ihre Form hin interpretieren – und auf die Frage hin: was steckt dahinter?
Deshalb ist es kein Versehen oder Unvermögen, dass die Bibel Theologie in Erzählungen und Gleichnissen betreibt. Uns Heutigen fehlt vielfach der kulturelle Background von damals, um über die Pointen sofort lachen zu können. Zugleich können wir heute zu Assoziationen finden, auf die die Damaligen niemals gekommen wären. Die Geschichte von der Dämonenaustreibung in Gerasa (Mk 5,1-20) beispielsweise ist eigentlich ein Schenkelklopfer. Sie macht sich nicht nur über die bösen Geister lustig, sondern zieht nebenbei noch eine römische Legion ( X Fretensis , die unter anderem das Emblem eines Ebers trug) durch den Kakao: „Lass uns doch in die[se] Schweine hineinfahren!“ (12). Das ist Satire der direktesten Art, zwischen politischem Kabarett und unterhaltsamer Comedy. Ohne diesen Kontext aber schütteln wir nur verwundert den Kopf und stellen uns zweitausend Schweine vor, die sich besessen in den See stürzen.
GEWOLLT ODER UNGEWOLLT KOMISCH
Von außen betrachtet erwecken religiöse Praktiken unmittelbar den Eindruck des Komischen, von der außergewöhnlichen Kleidung angefangen bis hin zu den eigenartigen Verhaltensweisen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten noch nie in Ihrem Leben an einem Gottesdienst teilgenommen oder noch nie von einem solchen gehört, Sie würden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Beim zweiten Eindruck würden Sie vielleicht die Lächerlichkeit des Ganzen empfinden, das da von den Beteiligten mit größter Ernsthaftigkeit vollzogen wird. Kirchen legen schon beim Betreten einen besonderen Habitus der ernsten Andacht nahe. Sie scheinen kein Gelächter zu vertragen. Ironische Betrachtungsweisen finden sich schnell dem Verdacht der Blasphemie ausgesetzt. Darum dreht sich zum Beispiel Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose/Il nome della rosa“. Er bezieht sich auf die Benediktsregel über die Demut: „Der Mönch ist nicht leicht und schnell zum Lachen bereit, steht doch geschrieben: ‚Der Tor bricht in schallendes Gelächter aus’ (Sir 21,20).“ Gottesfürchtige lachen nicht. Ihr Geist verliert nicht die Kontrolle über den Körper. In dieser ganzen Ambivalenz findet sich im Christentum – mit anderen Religionen zusammen, allen voran dem Judentum – von den biblischen Schriften angefangen, bis in die Praktiken und Äußerungen über die Jahrhunderte hin, eine reiche Tradition des Humors.
Das Buch Jona zum Beispiel, aus dem hebräischen Tanach, präsentiert sich in der literarischen Form der ironischen Selbstkritik: Jona, der auf das Wort Gottes hört, ist um keinen Ausweg und kein Argument verlegen, sich durch dieses Wort gerade nicht von seinen Glaubensüberzeugungen abbringen zu lassen. Doch die göttliche Phantasie schlägt seiner Trägheit jedes Mal ein Schnippchen. Schließlich zieht sich Jona beleidigt in den Schatten eines Laubdachs zurück, das er sich gebaut hat, um abzuwarten, was er sich schon immer gedacht hat: die Stadt Ninive wird vom Zorn Gottes verschont bleiben, weil Gott wieder einmal weich geworden ist. „Da ließ Gott, der Herr, einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte“ (Jona 4,6f.) und Jona der prallen Sonne aussetzte. Diogenes lässt grüßen.
SPÖTTISCHE KRITIK AN ÜBERZOGENER FRÖMMIGKEIT
Das Psychogramm eines Gottesfürchtigen, das hier in einer pointenreichen Odyssee-Geschichte erzählt wird, ist entlarvend und voller Spott. Es deckt die gar nicht so frommen Motive hinter der Frömmigkeit schonungslos auf. Das Buch Kohelet aus der gleichen Epoche wie das Buch Jona bietet ähnliche Kritik in aphoristischer Form, deren Ironie sich für uns nicht immer sofort erschließt, zum Beispiel: „Besser sich ärgern als lachen; denn bei einem vergrämten Gesicht wird das Herz heiter“ (Koh 7,3). Ernst kommt hier daher, was in Wirklichkeit spöttische Kritik am frommen Gehabe ist.
In beiden biblischen Büchern findet sich vorweggenommen, was in Nietzsches Religionskritik Jahrtausende später unter neuzeitlichen und modernen Voraussetzungen entfaltet ist. Ebenfalls in der ästhetischen Form der ironischen Übertreibung zeichnet sie den frommen Typus bis zur Kenntlichkeit. Er münze den Geist des Ressentiments, das heißt den uneingestandenen Zorn der Unterlegenen, der auf Rache und Vergeltung sinne, in ein Gefühl der moralischen Überlegenheit um. Er sei „weder aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu. Seine Seele schielt; sein Geist liebt Schlupfwinkel, Schleichwege und Hinterthüren, alles Versteckte muthet ihn an als seine Welt, seine Sicherheit, seine Labsal; er versteht sich auf das Schweigen, das Nicht-Vergessen, das Warten, das vorläufige Sich-verkleinern, Sich-demüthigen“ ( Nietzsche , Nr. 10; vgl. Nr. 13).
STULTITIA, LEVIATHAN UND RISUS PASCHALIS
Das Christentum war – ebenso wie andere Religionen – von Anfang an dem Spott ausgesetzt, wie die auf dem Palatin in Rom entdeckte älteste Karikatur eines gekreuzigten Esels aus dem 2. Jahrhundert belegt: „Alexamenos sebete theon“ – „Alexamenos betet Gott an.“ Zugleich greift die christliche Theologie selbst auf die Form der Ironie zurück, und zwar keineswegs nur am Rand, sondern am Puls des Glaubens. Drei Motive mögen an dieser Stelle als Beispiele genügen: (1) die Torheit des Kreuzes (stultitia), (2) die Überlistung des Teufels (Leviathan) und (3) das Ostergelächter (risus paschalis).
(1) Die Narretei, auf die die Esels-Karikatur anspielt, wird bei Paulus als Logik des Kreuzes verkündet. Demnach verkörpert diese närrische Torheit eine Weisheit, die die Weisheit der Welt in ihrer Torheit entlarvt (vgl. 1 Kor 1,18-31). Diese Logik provozierte in der Antike nicht nur religionskritische Äußerungen eines Celsus zum Beispiel (vgl. Fresacher 2010), sondern auch asketische Figuren, die sich zum Narren um Christi willen machten und bis heute beispielsweise in den Bettelorden ihren Nachklang finden, oder in der Renaissance eine Liebe zur satirischen Kirchenkritik, wie sie im „Lob der Torheit“ des Erasmus von Rotterdam in die derbe Rede der Närrin Stultitia gekleidet ist – immer am schmalen Grat zwischen Beifall und Verurteilung (vgl. Greenblatt ): wer glaubt, macht sich zum Narren.
(2) Die Darstellung des geköderten Leviathan in Text und Bild untermalte – trotz antiker Bedenken – die gängige Erlösungsvorstellung des Mittelalters (vgl. Zellinger ). Sie wirkt bis heute in der frommen Alltagstheologie nach. Darin geht der Teufel dem Gottessohn in Menschengestalt auf den Leim. Er verschlingt im Tod am Kreuz mit dessen menschlicher Natur auch die göttliche. Damit begeht er einen folgenschweren Fehler: die Rettung der Menschen. Denn aufgrund der Gottheit kann er die Menschheit nicht behalten. Er muss den Gottessohn wieder ausspeien und mit ihm die ganze Menschheit von den biblischen Patriarchen angefangen. Auf diese Weise entreißt Christus dem Teufel und mit ihm dem Tod alle Menschen. An der rettenden Angelschnur werden sie aus dem Rachen des Leviathan nach oben gezogen. So – paradox – geht Erlösung. Daran hängt der mächtige Gnadenapparat der Kirche. Am Kreuz treibt Gott seinen Schabernack mit seinem Gegenspieler. Er führt den Siegessicheren in seiner Dämlichkeit vor. Sein Stolz ist sein Fall. Dankbare Demut und Bescheidenheit sind stattdessen als Tugend angesagt. Dieses Motiv von der Überlistung des Teufels findet sich in mittelalterlichen Mysterienspielen wieder und von dort Eingang in die Kunst – vom Märchen „Der Schmidt und der Teufel“ bis hin zu Hofmannsthals „Jedermann“: am Kreuz macht sich der Stolze lächerlich.
Читать дальше