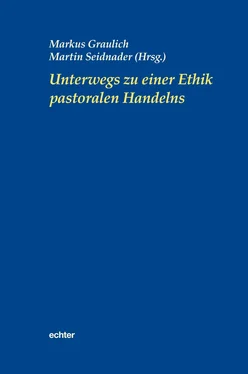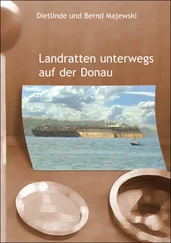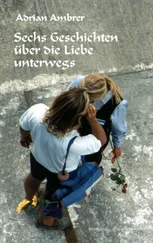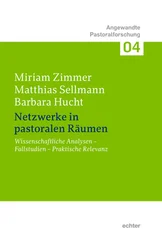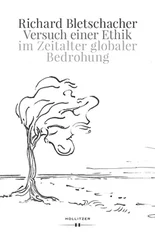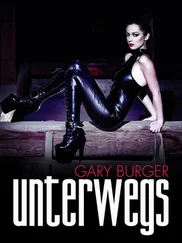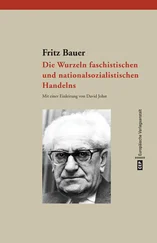12 M. Konradt , Instruction, S. 137.
13 M. Konradt , Instruction, S. 138.
14Vgl. dazu J. Becker , Paulus. Der Apostel der Völker, Tübingen 21992, S. 464: Basis der spezifisch paulinischen Ethik sei die Heiligung des Christen. „Jedoch spielt das Liebesgebot zweifelsfrei eine viel herausragendere Rolle“ (ebd.). Dabei ist die Liebe „meist der unbequemere Weg, der das Gesamtwohl im Auge hat. Nicht die eigenen Bedürfnisse und Interessen des Menschen […], vielmehr die Hingabe aufgrund der zuvorkommenden Hingabe Christi sind ihr Orientierungsrahmen“ (ebd.). Dabei beruht die Verbindlichkeit des Liebesgebotes „auf dem Gesamtsinn der göttlichen Heilszuwendung in Christus […], nicht aber auf Christus als Lehrer“ (a.a.O., S. 462), also weniger auf der Jesustradition als auf dem urchristlichen Kerygma.
15Vgl. M. Wolter , 'Let no one seek his won, but each one the other's' (1 Corinthians 10,24): Pauline ethics according to 1 Corinthians, in: J. G. van der Watt (Hrsg.) assisted by F. S. Malan , Identity, Ethics, and Ethos in the New Testament (BZNW 141), Berlin - New York 2006, S. 199-217, hier S. 212.
16 H. von Lips , Heiligkeit und Liebe. Kriterien christlicher Ethik am Beispiel des 1. Korintherbriefes, in: Ch. Böttrich (Hrsg.), Eschatologie und Ethik im frühen Christentum. FS Günter Haufe zum 75. Geburtstag (Greifswalder theologische Forschungen 11), Frankfurt a. M. u.a. 2006, S. 169-180, hier S. 176.
17Vgl. dazu H. von Lips , Heiligkeit, S. 176.
18Vgl. die sehr differenzierte Darstellung von D. Zeller , Konkrete Ethik im hellenistischen Kontext, in: J. Beutler (Hrsg.), Der neue Mensch in Christus. Hellenistische Anthropologie und Ethik im Neuen Testament (QD 190), Freiburg u.a. 2001, S. 82-98.
Salus animarum – suprema lex. Der Beitrag des Kirchenrechts zu einer Ethik der Seelsorge
Markus Graulich
Im Jahr 906 veröffentlicht Abt Regino von Prüm († 915) 1sein Sendhandbuch, 2welches vor allem als Hilfestellung für den Bischof bei der Visitation der Diözese und dem dabei abzuhaltenden Sendgericht 3gedacht ist. In Form von Fragen, welche der Bischof Klerus und Volk während der Visitation zu stellen hat, lässt Regino erkennen, welche Standards im pastoralen Handeln und in der Glaubenspraxis im Mittelalter gelten und gibt zugleich einen originellen Einblick in das Kirchenrecht seiner Zeit, denn jede der 185 Fragen wird mit einem oder mehreren Texten der universalen und partikularen kirchlichen Gesetzgebung belegt.
Einige der Fragen, welche Regino den Bischof stellen lässt, sind leicht und eindeutig zu beantworten, so etwa die Frage nach der Beschaffenheit von Kelch, Hostienschale und Korporale (Fragen 6 und 7), nach dem Vorhandensein der für die Feier der Hl. Messe und der anderen Sakramente erforderlichen Bücher (Fragen 10 und 11), der priesterlichen Gewänder (Frage 12) oder der ausreichenden Zahl von Kerzen (Frage 13). Schwieriger ist es schon, Antworten auf die Fragen nach dem Lebenswandel des Seelsorgers zu finden, etwa danach, „ob er in Verdacht ist wegen einer Frau oder er in sein Haus eine Frau eingeschmuggelt hat“ (Frage 18), „ob er die Kranken besucht, ob er ihnen Absolution erteilt“ (Frage 19), ob er Geld für die Sakramentenspendung nimmt (Frage 20) oder die Sakramente an Unwürdige spendet (Frage 39), „ob durch die Nachlässigkeit des Priesters irgendein Kind in der Pfarrei ohne Taufe gestorben ist“ (Frage 21), ob er trunk- oder streitsüchtig ist (Frage 21), ob er betet (Frage 28-29), „ob er dem Volk das Wort Gottes verkündet“ (Frage 33), „ob er Sorge trägt für Arme, Fremde und Waisen und sie, wenn es ihm möglich ist, zu seiner Mahlzeit einlädt“ (Frage 35), ob er zur Glaubensverkündigung in der Lage ist (Frage 82; 95) oder ob er die liturgischen Gebete und Vorschriften kennt (Frage 83-92).
Während die erste Gruppe von Reginos Fragen eher zu dem gehört, was landläufig unter Rechtsnormen verstanden wird, ist dies im Hinblick auf die zweite Gruppe von Fragen nicht so eindeutig zu sagen. Ihre Beantwortung reicht auch in den Bereich des ethisch relevanten Verhaltens bzw. ethisch relevanter Grundhaltungen hinein.
Wenn vor dem Hintergrund des historischen Beispiels von Reginos Sendhandbuch im Folgenden der Frage nachgegangen werden soll, worin der Beitrag des Kirchenrechts zu einer Ethik pastoralen Handelns liegen kann, ist daher zunächst etwas über die Eigenart des Kirchenrechts zu sagen, das sich nicht einfach auf die positiv-rechtlichen Normen reduzieren lässt, sondern sehr eng mit der Ethik bzw. mit der Moral verknüpft ist, und in ihnen seine Grundlage und seine Voraussetzung hat. Rechtspflichten und das Ethos des Handelns liegen im Kirchenrecht enger beieinander, als dies etwa in der staatlichen Rechtsordnung der Fall ist.
1. Die Eigenart des Kirchenrechts
Das Recht der Kirche ist nicht nur vom Begriff der Kirche her zu bestimmen und als eine Funktion des Kirchenbegriffs zu betrachten. Das Recht der Kirche hat es immer auch mit dem Selbstverständnis des Menschen zu tun, das sich in seinen verschiedenen Dimensionen im Lauf der Geschichte auch in rechtlichen Institutionen zum Ausdruck bringt, weshalb das Recht als eine Realität anzusehen ist, die an der Geschichtlichkeit des Menschen teilhat. 4Andererseits soll das Kirchenrecht auch immer an das neutestamentliche Ethos, an die Verkündigung und den Anspruch Jesu rückgebunden sein. 5In der Kirche sind daher Rechtsordnung und Heilsordnung zwar zu unterscheiden, aber nicht strikt voneinander zu trennen. Der vorpositive Grund der einzelnen Normen tritt im Kirchenrecht deutlicher hervor und spielt eine größere Rolle, als im staatlichen Recht. Was Kirchenrecht ist, wird auf der Grundlage der neutestamentlichen Heilsökonomie bestimmt. Von ihr her ergeben sich sowohl die pastorale Zielsetzung, als auch die Verhältnisbestimmung zwischen Recht und Ethos, denn „die communio fidelium ist ja nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, sondern auch eine sittliche Bewährungsgemeinschaft, ungeachtet der begrifflichen Unterscheidung zwischen Glauben und Sittlichkeit. Die ‘salus animarum’ ist an sittlichen Einsatz gebunden, wie des näheren auch immer das Zuordnungsverhältnis beider aussieht.“ 6
In gewisser Weise kommt dem Recht in der Kirche so etwas wie eine ethosstützende Funktion zu. Selbstverständlich gibt es auf Grund der Geschichtlichkeit der Erkenntnis und der Vielfalt der Kulturen auch in der Kirche eine gewisse Ungleichzeitigkeit, Rhythmusverschiebungen, unterschiedliche Freiheitsstände, welche der kirchliche Gesetzgeber zu berücksichtigen hat. Aber hinter all dem steht doch ein gemeinsames Menschenbild, das über hermeneutische Prozesse in die Erarbeitung des Rechts eingeht. 7
Dadurch ist es möglich, dass das Kirchenrecht den Menschen tiefer erreicht, und nicht nur – wie dies bei der staatlichen Rechtsordnung oft der Fall ist – eine rein äußere und äußerlich bleibende Größe darstellt. Es muss zwar darauf geachtet werden, Recht und Ethik zu unterscheiden, da sie zwei verschiedenen Bereichen angehören. Dennoch stehen sie aber nicht ohne Beziehung einander gegenüber, sondern die kirchenrechtliche Norm hat ihre Basis in der ethischen Norm und bleibt auf diese hin durchlässig, ohne dass das Recht die Moral ersetzen oder einholen könnte. Die moralischen Normen binden das Gewissen, die juristischen Normen das äußere Verhalten des Menschen, das aber von der moralischen Grundlage nicht zu trennen ist.
Aufgabe des kirchlichen Rechts ist es, auf der Grundlage des ius divinum und vor dem Hintergrund der Vorgaben des Lehramtes eine Rechtsordnung zu gestalten, welche der Sendung und den Zielen der Kirche gerecht wird, und zugleich Wege zu finden und aufzuzeigen, wie die Formen und Zuständigkeiten der konkreten Teilhabe an Handeln und Vollmacht der Kirche rechtlich geregelt werden können. Ordnung und Schutz der Pflichten und Rechte aller Gläubigen haben im Kontext der Communio des Volkes Gottes besondere Beachtung zu finden. Zugleich hat die Rechtsordnung der Kirche auf das Heil der Seelen ausgerichtet zu bleiben ( salus animarum – suprema lex ), was es erforderlich macht, dass dem Kirchenrecht auch eine gewisse Flexibilität eignet, ohne dass dadurch sein Rechtscharakter verloren gehen würde. Das Kirchenrecht hat das Ziel, der Gemeinschaft des Volkes Gottes eine Ordnung zu geben, vor deren Hintergrund und mit deren Hilfe sich die Sendung der Kirche verwirklichen lässt.
Читать дальше