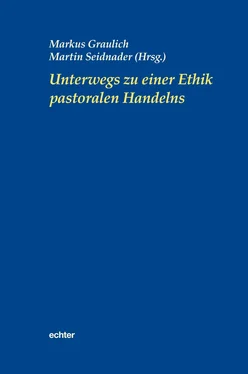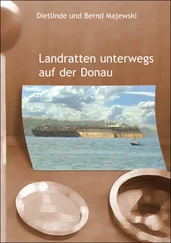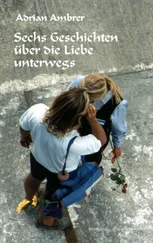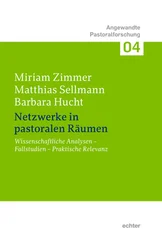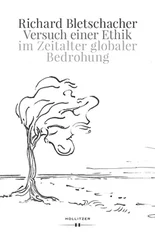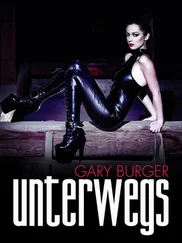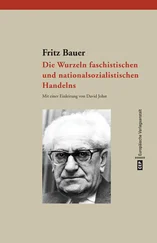Eine ähnlich zweigestufte Ethik finden wir in 1 Kor 6,1-11. 15Hier geht es um einen Rechtsstreit zwischen zwei Christen aus der korinthischen Gemeinde, den sie vor einem heidnischen Gericht austragen. Auf den Anlass dieses Streits geht Paulus nicht ein. Einige Stichworte im Text (V 7: „ausrauben“, V 10: „Diebe, Habgierige,…Räuber“) scheinen einen Streit um Eigentumsfragen anzudeuten. Für unser Thema wichtig sind die Alternativen, die Paulus zu dem Rechtsstreit vorschlägt. Da der Streit vor Außenstehenden dem Ansehen der Gemeinde schadet und somit die Mission erschwert, ist das Mindeste, was Paulus von den Streitenden erwartet, dass sie den Konflikt in der Gemeinde mit Hilfe eines zur Gemeinde gehörenden Schlichters lösen (1 Kor 6,5). Der ethisch höhere Weg wäre aber, wenn beide auf ihr Recht verzichteten (1 Kor 6,7). Hier liegt sicher Einfluss von Worten Jesu vor, die zum Verzicht auf Vergeltung und zum Ertragen von Unrecht aufrufen (Mt 5,39-41).
In der Frage des Genusses von Götzenopferfleisch (1 Kor 8) bezieht sich Paulus auch wieder nicht direkt auf ein Jesuswort, aber man spürt trotzdem deutlich die indirekte Prägung durch die Jesusverkündigung. Paulus fordert die liebende Zuwendung zum Mitchristen, auch wenn dieser in seiner theologischen Erkenntnis und in seinem Glauben noch unvollkommen ist. Diese Liebe soll sogar zum Verzicht bereit sein, wenn dies dem anderen auf seinem Weg zum Heil dienlich ist. Hier geht es um eine Frage, die für die Christen in einer überwiegend heidnischen, von vielfältigem Götterglauben geprägten Welt sehr bedrängend war: Darf man als Christ Götzenopferfleisch essen, also Fleisch, das mit heidnischem Kult in Berührung gekommen war, muss man es evtl. sogar, um seine Ablehnung der Götzen und seinen Glauben an den einen Gott zu dokumentieren, oder darf man es nicht? In der korinthischen Gemeinde stehen sich in dieser Frage zwei Gruppen gegenüber: Die sog. Starken sagen, man könne dieses Fleisch essen, das mit dem heidnischen Opferkult in Berührung gekommen ist, da es keine Götzen, sondern nur den einen Gott gibt und das Fleisch deshalb aus christlicher Sicht normales, profanes Fleisch ist. Die andere Gruppe, die Schwachen, wollen dieses Fleisch bewusst nicht essen, da aufgrund der Gewohnheit aus ihrer vorchristlichen Zeit dieses Fleisch sie noch mit den alten Göttern verbindet. Sie haben offenbar den Monotheismus noch nicht verinnerlicht. Für sie verbindet dieses Fleisch noch immer mit den heidnischen Göttern, von denen sie sich durch die Taufe losgesagt haben und die für sie eigentlich keine Götter mehr sein dürften. Das Problem besteht nun darin, dass die Starken ihre Position aggressiv vertreten und dadurch die Schwachen unter Druck setzen, so dass diese in Gefahr stehen, gegen ihre Überzeugung doch Götzenopferfleisch zu essen. Damit gefährden sie ihr Heil, so Paulus, denn dem Gewissen ist Folge zu leisten. Wenn die Schwachen nun gegen ihr Gewissen handeln, setzen sie ihr endzeitliches Heil aufs Spiel.
Obwohl Paulus theologisch den Starken im Prinzip Recht gibt, stellt er sich auf die Seite der Schwachen. Er fordert von den Starken, auf die Schwachen Rücksicht zu nehmen. Liebe soll ihr Verhalten bestimmen, Liebe zu dem schwachen Bruder, für den Christus starb (1 Kor 8,11). Die Liebe ist hier das entscheidende „Kriterium, das für das innergemeindliche Zusammenleben Relevanz hat (8,1).“ 16Heiligkeit und Liebe sind grundlegende Maßstäbe für das ethische Verhalten nach Paulus. Die Heiligkeit verbietet die Teilnahme an heidnischen Kultfeiern, die Liebe gebietet den Verzicht auf ein Verhalten, das eigentlich der theologischen Überzeugung nach erlaubt wäre. 17Paulus schärft hier also letztlich das Liebesgebot ein, das sogar den Verzicht auf ein Recht bedeuten kann, das man eigentlich hat. Der hohe Anspruch des jesuanischen Liebesgebotes wird von Paulus neu in Erinnerung gerufen. Er leitet sich bei ihm ab aus der Heiligkeit der Gemeinde und aus der Verpflichtung der Christen, alle Menschen zum Heil zu führen.
4. Die rigorose Position der Apokalypse des Johannes
In der Frage des Götzenopferfleisches nimmt die Johannes-Apokalypse eine erheblich strengere Position ein als Paulus. Mehrfach warnt sie davor, Götzenopferfleisch zu essen (Offb 2,14.20). Sicher ist die Situation eine andere als zur Zeit des Paulus. Angesichts einer aggressiven paganen Propaganda für den römischen Kaiser- und Götterkult in der Umgebung der Adressatengemeinden ist für die Christen praktisch ständig der status confessionis gegeben. Damit die Gemeinde nicht an Identität verliert und damit sie sich nicht in ihre heidnische Umwelt hinein auflöst, sind nach Ansicht des Verfassers der Apokalypse klare Grenzziehungen nötig. So verlangt er, dass die Christen auf jeglichen Kontakt mit heidnischen Kulten verzichten, auch wenn ihnen dies gesellschaftliche und materielle Nachteile bringt in einer Welt, die vom öffentlichen Kult geprägt war. Wenn man Handel treiben und wirtschaftliche Kontakte pflegen wollte, kam man unweigerlich mit Kulthandlungen und dem Fleisch aus solchen Handlungen in Berührung. Der Verzicht auf solche Kontakte konnte für den Einzelnen von großem materiellen Nachteil sein. In der Frage des Götzenopferfleisches greift die Offenbarung des Johannes nicht auf Jesusüberlieferung zurück. Zur Frage des Götzenopferfleisches ist kein Jesuswort überliefert; dieses Thema stellte sich nicht, da Jesus wie jeder fromme Jude solches Fleisch selbstverständlich nicht angerührt hat. Für unseren Durchgang durch das Neue Testament ist die Apokalypse aber insofern interessant, als sie zeigt, wie der christliche Prophet Johannes mit seiner offenbar anerkannten Autorität gegen mildere Tendenzen, die wir auch bei Paulus gefunden haben und die in den Adressatengemeinden der Apokalypse nicht wenige Anhänger haben, eine strengere Praxis durchsetzt. Johannes sieht seine Aufgabe darin, gegen Aufweichungstendenzen das christliche Profil zu schärfen. Dabei geht es ihm nicht um Profilierung an sich, sondern um den wahren Gottes- und Christusdienst. Dieser besteht in der Treue zu Christus und in der Bewahrung der Reinheit, die den Christen in der Taufe geschenkt wurde. Daraus ergibt sich ein besonderer ethischer Anspruch, den der Prophet wieder in Erinnerung rufen muss.
5. Konsequenzen für die pastorale Praxis
Wir haben gesehen, dass die neutestamentlichen Autoren die ethischen Forderungen Jesu in ihrer teilweise recht harten Radikalität nicht unverändert übernehmen. Sie reiben sich vielmehr an ihnen, sie passen sie ihren eigenen theologischen Konzeptionen und ihren jeweiligen seelsorglichen Situationen an. Dabei kommt es aber nicht nur zu einer Anpassung und Abmilderung, sondern in allen untersuchten Schriften und Schriftengruppen auch zu einer Verschärfung und weiteren Radikalisierung. Es scheint so, dass die ethischen Forderungen Jesu eine starke Nachwirkung hatten, auch wenn nicht in jedem Fall die unmittelbare Bezugnahme der neutestamentlichen Autoren auf die Jesusüberlieferung nachzuweisen ist. Der hohe ethische Anspruch in den neutestamentlichen Schriften ist aber ohne die Verkündigung Jesu nicht denkbar. Die ethischen Appelle Jesu wurden nicht als Gesetze verstanden oder als konkrete Normen, die unverändert zu bewahren und genau zu beachten seien. Vielmehr bilden sie eine Orientierung, an die man sich gebunden weiß und um die herum neue ethische Konzeptionen entstehen, die die Radikalität bewahren, gelegentlich sogar noch verstärken oder aber auch abschwächen, wobei der höhere Anspruch, der an Christen gestellt wird, durchgehend erhalten bleibt. Der besondere Anspruch der Ethik Jesu bildet also in den neutestamentlichen Schriften einen „Stachel im Fleisch“, der zur eigenen christlichen Identität gehört.
Ergänzend zu unserem Überblick ist festzustellen, dass neutestamentliche Autoren in nicht geringem Umfang ethische Konzepte und Argumentationen ihrer jüdischen und auch heidnischen Umwelt rezipieren. Man könnte dies an Laster- oder Tugendkatalogen, Haustafeln, an stoisch klingenden Formulierungen und nicht zuletzt auch an direkten positiven Bezugnahmen auf heidnische Wertvorstellungen zeigen. 18Gelegentlich wird in den neutestamentlichen Schriften sogar direkt vorausgesetzt, dass es eine gemeinsame Basis mit den ethischen Vorstellungen der heidnischen Umgebung gibt (1 Kor 5,1; 1 Petr 2,12.15). Eine einfache Anpassung an die ethischen Maßstäbe ihrer Umwelt kommt für die neutestamentlichen Autoren aber nicht in Frage. Maßstab für Ablehnung und Übernahme paganer Ethik ist die eigene christliche Überlieferung. So führt der neue christliche Glaubensinhalt auch zu einer Umprägung vorgegebener Normen. Überlieferte Worte Jesu, das Vorbild Jesu, das Bekenntnis zu seinem Tod und seiner Auferstehung und die Überzeugung von der Heiligkeit der Gemeinde aufgrund der Geistspendung in der Taufe führen zu einer selbstbewussten Ethik, die den Menschen fordert, die unbequem ist und die mehr vom Menschen verlangt, als in der jeweiligen Gesellschaft üblich ist.
Читать дальше