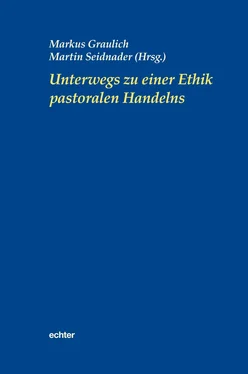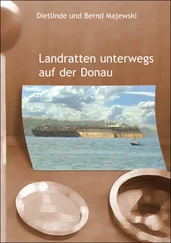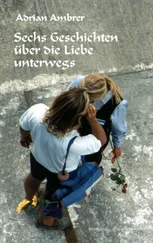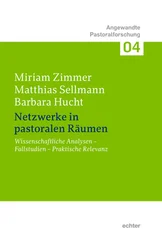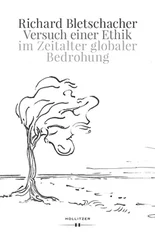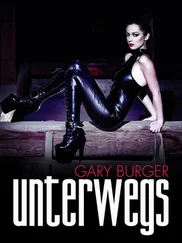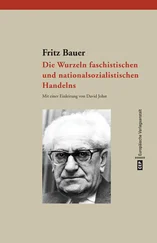Aus ihren Erfahrungen in der klinischen Seelsorge berichtet Christine Pöllmann . Im professionellen Umfeld vor allem auch eines Universitätsklinikums bestehen an die in der Pastoral Tätigen hohe Erwartungen, die eine spezielle Ausbildung voraussetzen und nur in enger Vernetzung, etwa mit den Ärzten und Pflegekräften, eingelöst werden können. Ethische Fragestellungen fordern in dieser Umgebung auch die Seelsorge unmittelbar heraus.
Der Fernsehjournalist Jürgen Erbacher benennt einige Aspekte zum Verhältnis von Kirche und Medien, um dann den eigenen kirchlichen Anspruch auf gelingende Medienarbeit und Kommunikation in Erinnerung zu rufen. Wo die Zusammenarbeit gelingt und in der Kirche hilfreiche Impulse aus der öffentlichen Wahrnehmung aufgenommen werden, besteht die Chance, dass auch das Anliegen einer Ethik pastoralen Handelns gefördert wird.
Als Kirche zu einer Ethik pastoralen Handelns unterwegs zu sein, verlangt auch, aus dem Glauben Zuversicht zu schöpfen. Es geht um die verantwortliche Zuwendung zu einer Welt, der die Botschaft des Herrn immer neu glaubwürdig verkündigt werden muss. Das eingangs genannte Hochgebet legt uns in den Mund: „Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi.“
Ich begrüße diesen Sammelband und danke den Herausgebern und allen Autorinnen und Autoren für ihre Initiative. Der intensive Dialog zwischen Pastoral und Ethik verspricht in Theorie und Praxis fruchtbare, weiterführende Einsichten. So wünsche ich dem wichtigen Gemeinschaftsband eine freundliche Aufnahme.
Mainz, im Juli 2011
Karl Kardinal Lehmann
Anspruch und Wirklichkeit. Der Umgang des Neuen Testaments mit den hohen Anforderungen der Ethik Jesu
Lothar Wehr
Kirchliche Positionen in ethischen Fragen treffen heutzutage in der Öffentlichkeit vielfach auf Unverständnis. Auch innerkirchlich wird teilweise heftig über sie diskutiert. Dies gilt für Fragen der Sexual- und Familienethik (besondere Wertschätzung der Ehe von Frau und Mann als Lebensbund, Unauflöslichkeit der Ehe), des Lebensschutzes vom ersten Moment der Existenz eines Menschen an bis zum natürlichen Tod, für das Festhalten an der priesterlichen Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, für die besonderen Ansprüche an Mitarbeiter im kirchlichen Dienst und vieles andere. Nicht selten wird der Vorwurf erhoben, die Kirche vertrete einen ethischen Rigorismus. 1Nun entwickelt die Kirche ihre Moral nicht aus sich selbst heraus, sondern letztlich in Treue zur Ethik Jesu und der frühen Kirche. So verwundert es nicht, dass sich der hohe Anspruch der Ethik Jesu in der kirchlichen Moralverkündigung wiederfindet.
Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie die ethischen Forderungen Jesu, die für sich betrachtet zum Teil rigoristisch klingen, in den Rahmen seiner Verkündigung und seines Menschenbildes einzuordnen sind und wie die neutestamentlichen Autoren mit diesem Teil der Jesusüberlieferung umgehen.
1. Die harten Forderungen Jesu angesichts der hereinbrechenden Gottesherrschaft
Am Anfang der Entwicklung zu einer spezifisch christlichen Ethik stehen die ethischen Forderungen Jesu. Soweit sie sich in den neutestamentlichen Evangelien – insbesondere bei den Synoptikern – erhalten haben, lassen sie ein klares Profil und einen hohen Anspruch erkennen. Wenn im Einzelnen auch strittig ist, welche Weisungen auf den historischen Jesus zurückgehen, so lassen sich doch einige Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit als authentisch erweisen. Das Gebot der Feindesliebe (Mt 5,44 par Lk 6,27f) zielt auf die völlige Entschränkung des Gebotes der Nächstenliebe (Lev 19,18) ab. 2Auch der persönliche Feind, derjenige, der mich in meinen Entfaltungsmöglichkeiten einschränkt, der mich meiner Freiheit beraubt und mir womöglich nach dem Leben trachtet, soll nicht nur nicht gehasst, sondern aktiv geliebt werden. 3Jesus selbst hat diese Feindesliebe in seiner Passion bis zur eigenen Lebenshingabe gelebt. In diesen Zusammenhang gehört auch die Mahnung Jesu, der Eskalation von Gewalt entgegenzuwirken und das Böse zu überwinden, indem man nicht nur auf das eigene Recht verzichtet, sondern sogar dem Bösen nachgibt: „Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin“ (Mt 5,39). Auch diese Weisung stimmt mit dem Verhalten Jesu selbst überein, der sich ungerechter Gewalt nicht widersetzt hat.
Einen hohen Anspruch stellt auch das Schwurverbot dar (Mt 5,34.37; vgl. Jak 5,12). Es hat einmal die Heiligung des Gottesnamens zum Ziel, fordert zugleich zur Wahrhaftigkeit im zwischenmenschlichen Bereich auf. 4Der Jünger Jesu soll immer die Wahrheit sagen und nicht nur, wenn er unter Eid aussagt. Schwören wird dann überflüssig, ja sogar gefährlich, insofern es dazu verführt, die Ehrlichkeit auf den Schwur zu begrenzen.
Auch das Verbot der Ehescheidung (Mt 5,32 par Lk 16,18; Mk 10,11 par Mt 19,9), das von Jesus ursprünglich unter der Voraussetzung jüdischer Rechtsverhältnisse formuliert war und das dem Mann verbot, seine Frau zu entlassen, setzt sich über die jüdischen Gepflogenheiten hinweg, die die Trennung erlaubten. Man stritt zwar im zeitgenössischen Judentum darüber, aus welchem Grund ein Mann seine Frau entlassen darf (vgl. Mt 19,3); dass die Trennung aber grundsätzlich erlaubt ist, war nicht zweifelhaft. Auch in dieser Frage ist also der Anspruch Jesu höher. 5
Mit dem Wort von den „Eunuchen um des Himmelreiches willen“ (Mt 19,12), das wegen fehlender direkter Parallelen im Frühjudentum, das sogar eine Pflicht zur Eheschließung aus der Tora ableitet, 6auf Jesus zurückgeht, hat Jesus auch seine eigene offenbar bewusst gewählte ehelose Lebensform begründet. 7Die Botschaft Jesu von der angebrochenen Gottesherrschaft fordert eine Antwort, die vieles relativiert, was im Allgemeinen als wertvoll und wichtig erachtet wird.
Auch in der Frage des Reichtums überliefern uns die Evangelien Jesusworte, die dem Menschen viel abverlangen. So dürfte wegen seiner auch sonst in der Verkündigung Jesu begegnenden Paradoxie und wegen der provokanten Radikalität, die kaum in der nachösterlichen Gemeinde entstanden sein kann, das Wort vom Kamel und dem Nadelöhr auf Jesus zurückgehen: „Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Himmelreich hineinkommt“ (Mk 10,25). Da Jesus nicht von allen seinen Jüngern den Verzicht auf jeglichen Besitz forderte, dürfte dieses Wort eher als Weckruf an die Reichen zu verstehen sein, denn als konkrete Anweisung, seinen ganzen Besitz abzugeben. Dadurch wird das Wort aber nicht wesentlich abgeschwächt. Da Reichtum daran hindern kann, ganz für Gott zu leben und sich ganz von ihm in Besitz nehmen zu lassen, beinhaltet die Nachfolge Jesu eine distanzierte Einstellung zum Besitz und unter Umständen, wie im Falle des reichen Mannes (Mk 10,17-22), sogar die völlige Aufgabe des eigenen Vermögens.
Die Interpretation dieser Forderungen und ihre Einordnung in eine Gesamtkonzeption der Ethik Jesu werden durch zwei Probleme erschwert. Erstens sind die ethischen Appelle Jesu in der Regel ohne ihren ursprünglichen Kontext überliefert; es ist also in den meisten Fällen nicht klar, aus welchem Anlass Jesus seine Forderungen formuliert hat. Zweitens ist es ein Kennzeichen der Verkündigung Jesu, dass er seine Ethik nicht systematisch darlegt; vielmehr hat er in der Regel spontan und veranlasst durch die Situation seine Forderungen formuliert.
Trotzdem lässt sich Folgendes feststellen: All die Forderungen Jesu verfolgen das Ziel, das Böse zu überwinden und dem Wohl des Menschen zu dienen. Sie sind nur zu verstehen vor dem Hintergrund der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu. Der Anbruch der endzeitlichen Herrschaft Gottes im Wirken Jesu verträgt sich nicht mit menschlichen Verhaltensweisen und Verhältnissen, die dem Wohl des Menschen abträglich sind. Ja, die heilende und vergebende Zuwendung Gottes ist so groß und umfassend, dass ihr nur ein ethisches Verhalten entspricht, in dem der Mensch gleichsam über sich selbst hinauswächst. 8
Читать дальше