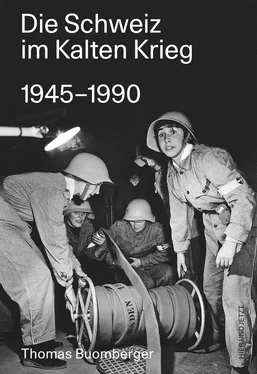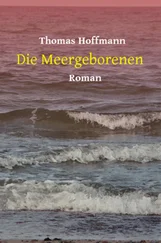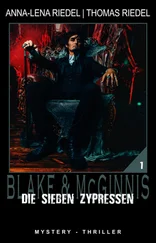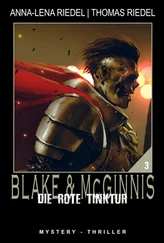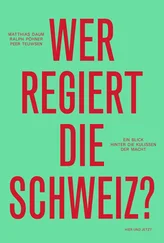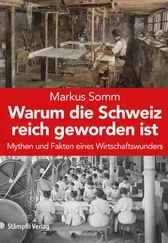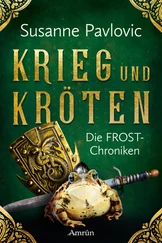Angesichts des ideologischen Verführungspotenzials der Nazi-Ideologie und der Krise der liberalen Demokratie sammelten sich die Kräfte der Mitte etwa in der Richtlinienbewegung, die einen Konnex zwischen wirtschaftlichem Wiederaufbau und der Sicherung der Demokratie machten und deshalb auf breite Resonanz stiessen. Praktisch parallel dazu verbreitete sich der Begriff der «Geistigen Landesverteidigung», der Ende 1929 auftauchte und sich später im Diskurs der Rechten verbreitete. Den Begriff für eine breite demokratische Allianz mehrheitsfähig machte Bundesrat Philipp Etter mit seiner Kulturbotschaft 1938. Die später als «Magna Charta» der Geistigen Landesverteidigung bezeichnete Botschaft wurde zum Kristallisationspunkt einer helvetischen Sammlungsbewegung und zu einem ideologischen Konstrukt, das seine Wirkung während mehr als 30 Jahren entfaltete.
Geistige Landesverteidigung: Abwehr gegen Nazi-Ideologie
Die am 9. Dezember 1938 veröffentlichte «Botschaft über die Organisation und die Aufgaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung» 15war die erste kulturelle Grundsatzerklärung des Bundesrates seit der Gründung des modernen Bundesstaates 1848. Ausgangspunkt der Überlegungen von Bundesrat und Kulturminister Philipp Etter waren die «tiefgreifenden Umwälzungen», die sich im geistigen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben Europas seit dem Ersten Weltkrieg abgespielt hätten und die ihren «Wellenschlag» auch in die Schweiz werfen würden. 16Die über 50-seitige Botschaft, von Philipp Etter grossenteils selbst und mit dem ihm eigenen Pathos verfasst, evozierte Bilder einer alpinen, wehrhaften Bauernnation, die am stärksten alleine ist. Auch 80 Jahre später wird dieses Konstrukt einer Tradition noch politisch instrumentalisiert, nämlich in der Politik der Schweizerischen Volkspartei (SVP) mit deren Eintreten für eine autonome bewaffnete Landesverteidigung oder dem Antagonismus gegenüber der Europäischen Union.
In Etters Botschaft «Sinn und Sendung der Schweiz» wird der Gotthard zu einem Bollwerk gegen die Ideologie des Nationalsozialismus, gleichzeitig ist um den Gotthard herum «eine geistige Gemeinschaft der Völker und Kulturen» entstanden, womit er auch eine Nähe zu Faschismus und Nationalsozialismus impliziert. In der ländlich-alpinen Gemeinschaft der alten Eidgenossen hatte die mythologisch verklärte Schweiz ihren Ursprung, der Mythos Gotthard wurde zur Geburtshelferin einer grossen Idee: «Der schweizerische Staatsgedanke ist nicht aus der Rasse, nicht aus dem Fleisch, er ist aus dem Geist geboren. Es ist doch etwas Grossartiges, etwas Monumentales, dass um den Gotthard, den Berg der Scheidung und den Pass der Verbindung, eine gewaltig grosse Idee ihre Menschwerdung, ihre Staatwerdung feiern durfte, eine europäische Idee, eine universelle Idee: die Idee einer geistigen Gemeinschaft der Völker und der abendländischen Kulturen.» 17Die Parallele zur Menschwerdung Jesu ist unverkennbar. Der Gotthard hat eine Doppelfunktion: mythisches Zentrum beziehungsweise Symbol des Schweizergeistes und Bollwerk gegen feindliche Armeen.
Etter plädierte dafür, dass sich die Kultur als Ausdruck «schweizerischen Geisteslebens und schweizerischer Eigenart» frei entfalten könne. In der «schöpferischen Tat» solle sich zeigen, was «schweizerisches Wesen ausmacht und bestimmt». 18Die Kulturbotschaft mit Betonung auf «schweizerisch» war als Abgrenzung gegenüber ausländischen Einflüssen zu verstehen. Etter blieb in seinen Umschreibungen und Vorstellungen einer Schweizer Kultur und Eigenart bewusst vage und blumig, sodass sich jede und jeder seine oder ihre je eigene Sicht bilden konnte. Dieses Fundament der Geistigen Landesverteidigung, ein Begriff, der nur selten in der Botschaft auftaucht, wurde zwar als Absage an eine totalitäre Kultur verstanden, war aber auch kein Bekenntnis zu einer offenen, liberalen Kultur, obwohl Etter die Zugehörigkeit zu den drei europäischen Kulturräumen und die kulturelle Vielfalt betonte. Etter sah das so: «Diese Aufgabe besteht darin in unserem eigenen Volke die geistigen Grundlagen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die geistige Eigenart unseres Landes und unseres Staates neu ins Bewusstsein zu rufen, den Glauben an die erhaltende und schöpferische Kraft unseres schweizerischen Geistes zu festigen und neu zu entflammen und dadurch die geistige Widerstandskraft unseres Volkes zu stählen.» 19Das patriotische Pathos Etters, das stellenweise an Duce Mussolini erinnerte, wurde im Volksmund allerdings ins Prosaische gedreht: Die Geistige Landesverteidigung wurde als «Ge-la-ver», also Geschwätz, abgekürzt, was bedeuten sollte, dass die hochgeschraubte Rhetorik wenig Substanzielles hervorgebracht hatte.
Etters Kulturbotschaft war massgeblich von Gonzague de Reynold inspiriert, der Ende der 1920er-Jahre die liberal-demokratische Staatsform kritisierte und in einer späteren Schrift die Vorzüge eines autoritären und föderalistischen Staates mit einem Landammann an der Spitze, der er selbst sein wollte, pries. Wie Gonzague de Reynold zeigte Etter Sympathien zu autoritären oder faschistischen Staatsmännern wie António de Oliveira Salazar in Portugal, Francisco Franco in Spanien oder Benito Mussolini in Italien. Von einem liberalen Staat hielt Etter, der 25 Jahre Bundesrat und deshalb spöttisch als «Etternel», der Ewige, bezeichnet wurde, wenig. So schrieb er in Die Vaterländische Erneuerung und wir, dass die Regierung nicht nur verwalten und vollziehen solle, sondern wieder regieren: «Mit einem Wort: Es sollen wieder stärkere Autoritätskörper in die Demokratie eingebaut werden. Und alles, was die Autorität hemmt und lähmt, soll verschwinden.» 20
Etter war Antidemokrat, Antimodernist und Antisemit. Der machtbewusste, auch widersprüchliche Politiker sah in einem christlich-berufsständischen Ständestaat von vor 1848 sein Ideal. Die elitären und autoritären Vorstellungen des begnadeten Redners waren mit dem Schweizer Staatsverständnis schwer in Einklang zu bringen. Als die Frontenbewegung nach der Machtübertragung an Adolf Hitler im Aufwind war, warb Etter – ein Jahr vor seiner Wahl zum Bundesrat – offen um die Gunst der frontistischen Wähler: «Die neue Bewegung (des Frontismus) richtet sich in ihren gesunden Äusserungen gegen eine Geistesart, die unmöglich unserer Verteidigung anvertraut sein kann. Im Gegenteil! Ich vertrete die Auffassung, dass vieles (freilich nicht alles!) in der neuen Bewegung durchaus gut ist und dem Inhalt unseres konservativen Staats- und Gesellschaftsprogramms entspricht.» 21Auch forderte er in derselben Schrift von 1933, dass im Namen der «geistigen Gesundheit» die Freiheit von Presse, Literatur und Kunst einzuschränken sei. Als «starke Trägerin der staatlichen Autorität» sollte die Armee eine wichtige Rolle erhalten. Sie sei «die Schützerin der geistigen und kulturellen Werte gegen die Kräfte der Zersetzung und des Umsturzes». 22Mit diesen Kräften meinte er weniger den Faschismus als den Kommunismus. Während des Zweiten Weltkriegs verfolgte Etter einen vorsichtigen Anpassungskurs an Nazi-Deutschland, und er war es auch, der die berüchtigte Rede von Bundesrat Marcel Pilet-Golaz von 1940, die als Kniefall vor Nazi-Deutschland interpretiert werden konnte, redigierte und auf Deutsch hielt. 23
«Antitotalitärer Kompromiss» und «helvetischer Totalitarismus»
Das kulturelle Programm der Geistigen Landesverteidigung war darauf ausgerichtet, Althergebrachtes und Traditionelles zu schätzen und zu würdigen, ohne dass aber ausländische Tendenzen, die oft unter dem Begriff «Kulturbolschewismus» angeschwärzt wurden, verurteilt worden wären. Die Botschaft einer schollenverbundenen, rückwärtsgewandten, alpinen und wehrhaften Bauernnation, die in gefährliche Nähe zur Blut-und-Boden-Ideologie der Nazis geriet, wurde gewissermassen in den Rang einer Staatsdoktrin erhoben, die ihre gewünschte Wirkung in der Kultur- und Bildungspolitik entfaltete. Hier bildete sich ein von rechtskonservativem Nationalismus durchdrungenes Gedankengut aus, das sich vorwiegend in der deutschen Schweiz breitmachte. Positiv lässt sich vermerken, dass sie die drei Landessprachen – später vier – fördern wollte.
Читать дальше