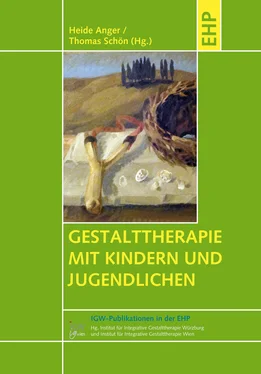Jene Kinder mit starken Bedürfnissen haben eine niedrigere Reizschwelle – ihre Kontaktgrenze erscheint durchlässiger als die anderer. Sie können z. B. störende Reize nicht so gezielt ausblenden. Dadurch sind sie empfindlicher, lassen sich leicht aus der Ruhe bringen und weinen oft untröstlich. Sie können sich mit der Zuwendung, die sie erhalten, nicht zufrieden geben. Sie sind wenig anschmiegsam, oft angespannt, sehnen sich aber nach viel Körperkontakt. Diese Babys finden schwer in den Schlaf und werden häufig wach. Bei der Nahrungsaufnahme zeigen sich die speziellen Bedürfnisse z. B. durch unstillbaren Hunger, besonders langes Nuckeln und Ablehnung von Löff elnahrung. Manche Babys sind erst in Schlafphasen bereit, zu trinken. Diese Kinder verfügen aber auch über die Fähigkeit, ihre Bezugsperson darauf aufmerksam zu machen, dass sie etwas stört, dass sie Hilfe und Zuwendung brauchen.
Diese Fähigkeit, das Mehr an Bedürfnissen (oder ein besonderes Eingehen auf die schwache Kontaktgrenze) zu initiieren, ist überlebenswichtig und sorgt im positiven Fall dafür, dass das Kind eben das erhält, was es braucht. Es kann aber auch sein, dass das vorerst ausgelöste Mitgefühl der Eltern zu Überforderung bis zu Vermeidungsreaktionen führt – was im gewissen Rahmen noch normal ist und schützt. Nehmen Belastung (Ausgelaugtheit, Frustration, Ängste, Hilflosigkeit, Schuldgefühle) und Vermeidung aber zu und das Bindungsverhalten weiter ab, ist therapeutische Intervention notwendig.
Neben der angeborenen niedrigeren Reizschwelle können ›stärkere Bedürfnisse‹ auch Folge von Projektionen eines Elternteils sein: Wenn die primäre Bezugsperson (bei Forderungen des Kindes z. B. nach Nähe, Zärtlichkeit, bei Wutäußerungen) von ihren eigenen Ängsten eingeholt wird und das Trauma in Gedanken/Bildern/Wahrnehmungen wiedererlebt, wird das Baby zur Projektionsfläche der unverarbeiteten traumatischen Erfahrungen (wachgerufene Affekte sind dann wie »Geister im Kinderzimmer«, wie es Fraiberg et al. (1975) nennen). Um sich Entlastung zu verschaffen, werden die negativen Gefühle auf das Kind projiziert, das dann als ängstlich/bedrohlich erlebt wird und sich in der Folge tatsächlich immer unruhiger, ängstlicher oder schreckhaft er verhält.
Einen hilfreichen Ansatz zum Schreien – die Abklärung der individuellen Fallgeschichte vorausgesetzt – bietet Aletha Solter (1995). Solter sieht im Schreien, neben dem Sinn der Kommunikation von grundlegenden Bedürfnissen, eine zweite wichtige Funktion, nämlich die eines positiven physiologischen Prozesses 3, der eine zentrale Rolle in der Auflösung von Traumata und der Wiederherstellung von Homöostase einnimmt.
Also im Gegensatz zu den gängigen Schreibaby-Interventionen, wo es um Beruhigung geht, schlägt Solter vor, Babys das Weinen aus Gründen der emotionalen Befreiung zu erlauben. So wie Weinen als notwendiger Teil eines Trauer- und Erholungsprozesses in der Psychotherapie von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen anerkannt wird, möchte Solter dies auch für präverbale Säuglinge verstanden wissen. Sie spricht sich für die Anerkennung der Intensität und Tiefe kleinkindlichen emotionalen Schmerzes aus.
Durch Weinen und Schreien können Babys Schmerzen und Anspannung lindern. Dies wird leicht nachvollziehbar, wenn wir an eine Impfung denken: Typischerweise schreit ein Säugling während und auch einige Minuten nach der Injektion; so werden körperlicher und emotionaler Schmerz (Angst, Verwirrung, Wut, womöglich Verrat) verarbeitet und entladen. Gründe für das Weinen sieht Solter neben dem momentanen emotionalen Schmerz in Kombination mit körperlichem Schmerz und unerfüllten Grundbedürfnissen auch, wie weiter oben erwähnt, in prä- und perinatalen Traumata, Überstimulation (z. B. laute Geräusche, helles Licht, viele Menschen) und Angsterfahrungen.
Wenn alle möglichen Bedürfnisse und medizinischen Ursachen einer Weinperiode ausgeschalten sind, bedeutet dieser Ansatz für die therapeutische Intervention, dass das Weinen der Stressreduzierung dient und damit eine heilsame Funktion hat, die die Bezugsperson unterstützend und zuhörend begleitet. Eltern können hier ihrem Kind eine empathische Akzeptanz des Schmerzes bieten. Sie sollten lernen, ihr Baby nicht immer nur glücklich sehen zu wollen, sondern auch die positiven Aspekte des Weinens zu verstehen, ohne sich inkompetent und hilflos zu fühlen.
Praktische Anwendung aus gestalttherapeutischer Sicht
Die Mutter, der Vater, die Eltern im Vordergrund
Geboren wird nicht nur das Kind
durch die Mutter,
sondern auch die Mutter
durch das Kind.
(Gertrud von Le Fort, 1950)
Je nachdem, welche Ausprägung von Störung im Mutter-Kind-Feld vorliegt – ob leichte Irritation bis schwere Erschütterung –, kann die Behandlungsdauer durchschnittlich bei nur drei bis fünf Sitzungen liegen oder eine längere Therapie der Traumafolgen notwendig machen (im deutschsprachigen Raum liegt der Elternanteil, der solche ungelösten traumatischen Erfahrungen gemacht hat, bei ca. dreißig Prozent (vgl. Brisch 2007)).
Im Folgenden möchte ich auf jenen Arbeitsfokus eingehen, in dem bei Vorliegen kindlicher Regulationsschwierigkeiten (als Folge oder Ursache) Self-Support und/oder Support nicht ausreichend verfügbar sind. Also wo zwar vorerst die Eltern über innerpsychische und soziale Ressourcen verfügen, aber in der Folge durch das spezielle Temperament des Kindes die individuellen Bewältigungsmechansimen erschöpft sind und es gilt, sekundären psychischen Beeinträchtigungen vorzubeugen.
In einer gelungenen empathischen Kontaktfindung kann die erste heilsame Wirkung erlebt werden. Das (oft erstmalige) Erzählen der prä-, peri- und postpartalen eigenen Geschichte ist eine Hilfe zur Konsolidierung der Erlebnisse. Neben kognitivem Verständnis für die Situation werden aff ektive Dimensionen geordnet und traumatische Geschehnisse im Dialog mit der Therapeutin eingeordnet.
Ich begegne den Betroffenen mit Empathie und Respekt. Ich treffe sie bzw. hole sie dort ab, wo sie gerade stehen. Ich bemühe mich, sie zu verstehen und nicht zu verurteilen, auch wenn sie mir Dinge erzählen, die grausam und hart ihrem Kind gegenüber klingen (schlagen, weinen lassen u. ä.).
Durch die gestalttherapeutische phänomenologische Haltung unterstütze ich mit einer explorierenden, konzentrierten Wahrnehmung der mütterlichen Perspektive ohne unterbrechende Tipps und Abschwächungen. Dies zeigt sich immer wieder als eine ganz wichtige Arbeitsbasis. Auf diese aufbauend können prägende oder traumatisierende Erlebnisse aufgearbeitet werden.
Im Weiteren konzentriert sich die Arbeit auf die introjizierte Grunderfahrung 4der Mutter. Wir beschäftigen uns mit der neuen Identität als Mutter: Welche Erwartungen gab es vor der Geburt, welche Fantasien? Welche Vorstellungen zum Muttermythos gibt es hier und jetzt? Wann bin ich eine gute Mutter? Was muss eine gute Mutter alles ertragen, um eine solche zu bleiben? Wie perfekt muss eine gute Mutter sein? Mich interessiert, wie die Betroff ene mit ihren Fehlern umgeht – was sind überhaupt Fehler in ihren Augen und wie bewertet sie welche Fehler?
Desweiteren frage ich nach den subjektiven Vorstellungen der Mutter zu ihrem Baby vor und nach der Geburt. Wie erlebt sie ihr Kind? Welche Projektionen gibt es? Überträgt sie introjizierte Grunderfahrungen auf das Baby? Wir arbeiten mit der bisherigen Wahrnehmung (z. B. »Was nimmst du wahr an deinem Kind, dass du zu dieser und jener Ansicht kommst?), um zu mehr und einer genaueren Wahrnehmung zu gelangen (Was nimmst du noch wahr, was siehst du außerdem?) Damit kann Frustrierendes oder Beängstigendes, was bisher durch Projektion mit dem Kind verbunden war, aufgelöst werden.
Die Intuitionsstärkung beginnt meist mit dem Besprechen von Unsicherheiten wie z. B.: Verwöhne ich mein Baby, wenn ich so und so handle? Meine Freundin warnt mich, mein Baby zu mir ins Bett zu nehmen …? Und mit dem Herausfiltern von: Was will ich? Was glaube ich wirklich, sei das Beste? Und: Was glauben die anderen, sei das Beste? Daraus ergeben sich Klärung und Bestärken des eigenen Gefühls. Die Mutter kommt wieder in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und findet zu ihrem individuellen Weg. Ziel ist ein angstfreies Verlassen auf die eigenen intuitiven Kompetenzen und auf die ihres Kindes. Dabei wirkt eine umfassende Information zu den (prä- und postnatalen) Kompetenzen eines Säuglings (z.B. differenziertes Gefühlsleben, Sinneswahrnehmungen in Beziehung setzen können, Geruchserkennung der Mutter, aktive Reizsuche u.v.m.) zusätzlich sicherheitsgebend.
Читать дальше