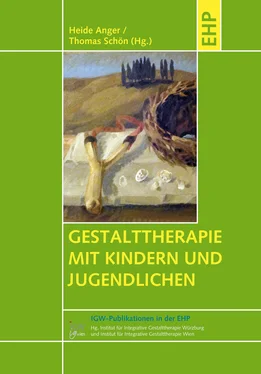Drei andere Autoren, Lynne Jacobs (Ph. D. in L.A.), Elaine Breshgold (Ph. D. in Washington) und Stephen Zahm (Gestalttherapeut in Oregon) nutzen die sogenannte »Selbstpsychologie« und die »Intersubjektivitätstheorie« als Grundlage für eine Entwicklungsperspektive in der Gestalttherapie (1992). Dies sind moderne psychoanalytische Theorien, die auf der Anerkennung der Bedeutung der Beziehung für die Entwicklung eines kohärenten Selbstempfindens basieren.
Margherita Spagnuolo-Lobb und Giovanni Salonia (Gestalttherapeuten in Italien) formulieren, dass das Schlüsselkonzept für Entwicklung der Kontakt sei (1993, in: Fuhr 1999). Sie beziehen sich auf bekannte Entwicklungstheoretiker wie Margaret Mahler und den weiter oben erwähnten Daniel Stern.
Nach Cathrin Tamis-Le Monda sind sechs Kernprinzipien für das Feld der Entwicklungspsychologie wesentlich:
1. Die Konstruktion von Wissen ereignet sich in einem sozialen Kontext.
2. Umwelteinflüsse geschehen auf vielen Ebenen und wirken wechselseitig (Individuum/Umwelt).
3. Entwicklung entfaltete sich in einer bestimmten historischen Ära.
4. Spezifische Aspekte der Umwelt wirken auf ganz spezifische Weise auf die Entwicklung einer Person.
5. Entwicklung ist wechselseitig.
6. Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess (vgl. Fuhr 1999)
Zur Untermauerung der Sichtweise, dass Entwicklung ein Feldprozess sei und wechselseitig ablaufe, wird das Kontingenzparadigma angeführt. Hierbei geht es um die Wichtigkeit des bewirkten Zusammenhanges in der frühesten Entwicklungszeit. Gemeint ist die kindliche Entdeckung des Zusammenhangs von eigener Aktivität und der danach folgenden Veränderung in der Außenwelt (Beispielexperiment: Je nach Saugfrequenz des Babys kann ein angenehmer Reiz ausgelöst werden). Dieser Zusammenhang (vom Saugmuster / eigene Aktivität) und dem Effekt (Veränderung in der Außenwelt) wird Kontingenz genannt.
Säuglinge lernen das auslösende Muster schnell, wiederholen es dann immer wieder und zeigen freudige Erregung beim Effektauslösen. Ändert man das Auslösemuster, reagiert der Säugling so, dass er vorerst seine Aktivität verstärkt, er bewegt z.B. den Kopf hin und her und vokalisiert, sucht also nach Alternativen; schlagen die Versuche fehl und zeigt sich kein Erfolg, kommt es zu deutlichen Vermeidungs- und Abwendungsreaktionen bis zu Dekompensation (vgl. Papousek 1975, in: Dornes 1997).
Kontingenzexperimente zeigen, dass neben der Trieb- und Körperlust auch die Entdeckerlust ein zentraler Motivator von Lebensbeginn an ist; und ebenso das Gefühl, in der Außenwelt sinnvolle Zusammenhänge bewirken und erkennen zu können.
Generell scheint Kontingenz wachstumsfördernd zu sein – denn Säuglinge, die kontingent stimuliert werden, lächeln mehr, lernen schneller, sind länger aufmerksam und weniger nervös (vgl. Lewis et al. 1985, in: Dornes 1997).
Zur Relevanz der Bindungstheorie im Rahmen der gestalttherapeutischen Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern
Die Bindungstheorie geht auf John Bowlby, englischer Psychiater und Psychoanalytiker, Mitte der 50er Jahre zurück. Sie wird an vielen anderen Stellen ausführlich beschrieben und soll daher hier nur knapp, jedoch der Bedeutsamkeit wegen angeführt werden. Die Relevanz der Bindungstheorie sehe ich für die Gestalttherapie:
• in der Erkenntnis und theoretischen Ausformulierung, dass frühe Erlebnisse, (wie Trennung von der Schlüsselbezugsperson oder Misshandlung) auch später eine Bedeutung haben und sich als pathogene Faktoren im Bindungs-/Kontaktverhalten auswirken können (Störung als Reflexion früher Erfahrungen),
• in der Erkenntnis, dass die Verfügbarkeit von Bezugspersonen in frühen Jahren ausschlaggebend sein kann für die Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen,
• in der Erkenntnis, dass eine Verhaltensbeobachtung von Kindern mit ihren Eltern wichtige Informationen für Diagnostik und in der Folge für die therapeutische Behandlung bietet (Minde, in: Spangler, 1995) und
• in der Untermauerung, wie enorm wichtig eine »sichere Basis« für den Klienten im therapeutischen Kontext ist – denn nur so kann er sich, schmerzhaft en Themen nähern und zu seiner Selbstunterstützung und seinen Ressourcen finden.
• Die theoretische Formulierung führt zu wissenschaftlicher Überprüfbarkeit und zu den wichtigen präventiven Interventionen.
Nach Bowlby werden die frühkindlichen Bindungserfahrungen für zwischenmenschliche Beziehungen verinnerlicht wie eine Art »Arbeitsmodell«. Somit haben alle Befunde zur menschlichen Frühentwicklung Konsequenzen für die psychische Belastbarkeit des weiteren Lebens, für das In-Einklang-Sein von Gefühlen, die emotionale Ausgeglichenheit, für das Verhalten in sozialen Situationen und für die Frustrationstoleranz.
Eine direkte terminologische Umlegung des »sicheren Bindungsmodells« auf das Gestaltkonzept erscheint nicht einfach, denn schon die Dauerhaft igkeit, die der Begriff »Bindung« impliziert, steht im Kontrast zum Momentanen des Kontakt-Begriffes. Stimmig erscheint mir die Benennung »Modell der inneren Kontaktsicherheit«.
Mary Ainsworth (1913-1999), Psychologin und Mitarbeiterin in Bowlbys Forschungsgruppe in London, ist es zu verdanken, dass dessen Thesen über die Bedeutung der frühen Mutter-Kind-Beziehung empirisch belegt werden konnten und erstmals eine Skala zu mütterlicher Feinfühligkeit und eine Klassifizierung des Bindungsverhaltens entworfen wurde. Mit Feinfühligkeit der Bindungsperson ist die Wahrnehmung der Verhaltensweisen des Säuglings, die zutreffende Interpretation dieses Verhaltens, die prompte Reaktion auf seine Äußerung und die Angemessenheit der Reaktion gemeint (vgl. Ainsworth 1978).
Ainsworth und ihre MitarbeiterInnen konnten drei verschiedene Qualitäten von Bindungsverhalten zwischen Bezugsperson und Kind beobachten (A) avoiding – unsicher-vermeidend, B) balanced – sicher gebunden, C) crying – ambivalent-unsicher; eine vierte Bindungsqualität D) disoriented – desorientiert/desorganisiert kam 1986 von Main & Solomon hinzu).
Aus den Erfahrungen also, die ein Kind in seinem ersten Lebensjahr macht – interaktiv und kommunikativ – resultiert ein Gefühl von Gebundenheit; je nach den Erfahrungen kommt es zu verschiedenen »Färbungen«, die eben die verschiedenen Qualitäten von Bindung ergeben.
Auch biologisch orientierte Disziplinen (wie z.B. die vergleichende Verhaltensforschung) haben sich mit der Bindungstheorie befasst. Von Untersuchungen an Tieren ausgehend ließen sich Belege für neurobiologische Grundlagen finden. Vor allem limbische Strukturen – besonders die Amygdala – sind an der Konstitution des Bindungssystems beteiligt. Weiterhin konnte die Beteiligung von Gehirn-Opioiden im sozio-emotionalen Entwicklungsprozess nachgewiesen werden (Opioide sind hirneigene Stoffe, die eine schmerzstillende und beruhigende Wirkung haben). In Tierexperimenten konnte eindeutig belegt werden, dass sozialer Affekt und Bindung (Zuwendung, Körperkontakt) zu einer Opioid-Ausschüttung und damit zu Beruhigung führt (vgl. Panksepp et al. 1985, in: Suess 2001).
Eine Längsschnittstudie von Spangler und Grossmann (1993) zeigte auch bei Kindern einen eindeutigen Zusammenhang von Verhalten in einer Bindungs-Stresssituation und physiologischer Reaktion: während einer kurzen Trennung der Hauptbezugsperson wurde simultan die Herztätigkeit gemessen. Alle Kinder zeigten dabei ein Ansteigen ihrer Herzfrequenz, was auf physiologische Erregungsprozesse hinweist, die im Allgemeinen mit der Aktivierung des Bindungsverhaltens einhergehen (vgl. Suess 2001).
Weitere Untersuchungen wurden zur Cortisol-Ausschüttung durchgeführt (Hypophysen-Nebennierenrinden-System). Gemessen an Speichelproben 12 Monate alter Kinder zeigte sich, dass jene Kinder, die bis dahin keine Verhaltensstrategien entwickeln konnten, um mit einer Trennungssituation fertig zu werden (wie z.B. mittels Weinen und Protest), ein deutlich erhöhtes Cortisolniveau hatten.
Читать дальше