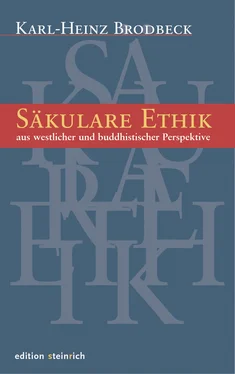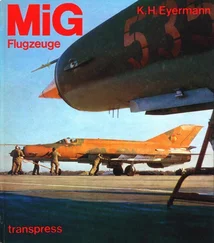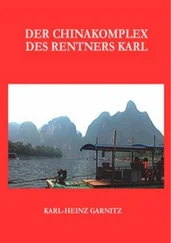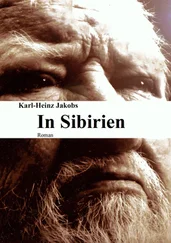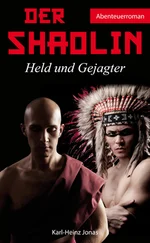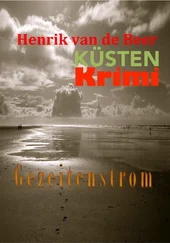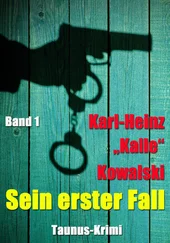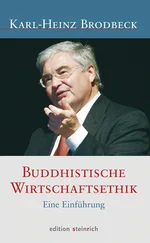Karl-Heinz Brodbeck - Säkulare Ethik
Здесь есть возможность читать онлайн «Karl-Heinz Brodbeck - Säkulare Ethik» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Säkulare Ethik
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Säkulare Ethik: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Säkulare Ethik»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Säkulare Ethik — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Säkulare Ethik», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Eine auf den ersten Blick raffinierte Begründung, weshalb man dennoch der Offenbarung vertrauen soll, hat Blaise Pascal entwickelt. Als Philosoph und Mathematiker war er mit dem Glücksspiel vertraut. So versuchte er, die Entscheidung für den Glauben an die Offenbarung durch ein Glückskalkül, die berühmte Pascal’sche Wette, zu begründen. Der Gedanke ist einfach zu skizzieren: Pascal betrachtet die Entscheidung, zu glauben oder nicht zu glauben, als eine Entscheidung unter Unsicherheit. Sich für oder gegen den Glauben zu entscheiden ist aber kein Abwägen von gleichartigen Gütern, meint er.{39} Die Kosten, der Aufwand, den die Moral von uns verlangt, sind relativ niedrig. Aber der zu erwartende Lohn, die ewige Seligkeit, ist ein unendlicher Gewinn. Wenn es nun auch nur – das wird auch ein Skeptiker zugeben – eine winzige Chance gibt, dass die Offenbarung wahr ist, dass die versprochene Seligkeit als Lohn für moralisches Handeln unendlich ist, dann ist der erwartete Gewinn immer noch unendlich. Denn: Eine noch so kleine Wahrscheinlichkeit mit einer unendlichen Größe multipliziert, ergibt immer noch eine unendliche Größe. Die Waagschale schlägt also eindeutig zugunsten des Glaubens aus. Selbst wenn man nicht überzeugt ist – Pascal vertritt eine Morallehre, die nur auf das faktische Handeln, nicht die innere Überzeugung blickt –, so ist der Lohn überragend. Ist das Gegenteil der Fall, trifft also das offenbarte Versprechen der ewigen Seligkeit nicht zu, so hat man kaum etwas verloren. Im Gegenteil. In diesem Argument liegt Pascals säkular-ethische Konsequenz aus seiner Wette. Er sagt zu einem Gesprächspartner, dem er seine Wette schmackhaft machen will: Falls Sie die Wette verlieren (es gibt keine ewige Seligkeit), dann besteht immer noch ein positiver Nutzen.
»Sie werden treu, ehrbar, demütig, dankbar, wohltätig, ein aufrichtiger und wahrhafter Freund sein. In Wahrheit: Sie werden sich nicht mehr in verpesteten Vergnügungen aufhalten, in der Ruhmsucht, in den Genüssen (…). Ich sage Ihnen, Sie werden in diesem Leben dabei gewinnen; und Sie werden bei jedem Schritt, den Sie auf diesem Wege tun, Ihren Gewinn so sicher und Ihr Wagnis so nichtig sehen, bis Sie schließlich erkennen: Sie haben um etwas Sicheres, Unendliches gewettet, für das Sie ein Nichtiges hingaben.«{40}
Pascal nimmt hier eine utilitaristische Argumentation vorweg (vgl. Kapitel 2.5). Seine Wette hat somit eine doppelte Bedeutung: Einmal soll sie durch Nützlichkeitsabwägungen zum Glauben, wenigstens zur Glaubenspraxis auch ohne innere Überzeugung überreden. Hier schlägt die Waage durch das Wahrscheinlichkeitsargument scheinbar eindeutig dafür aus, den Glauben einfach anzunehmen, ohne weiter nachzufragen. Zum anderen aber sagt Pascal, dass jemand, der die christliche Moral annimmt, dadurch selbst einen Vorteil hat – und damit auch die ganze Gesellschaft: Man wird treu, ehrbar, demütig, dankbar und wohltätig. Auch hier argumentiert Pascal rein funktional: Es ist unwichtig, ob man den Sinn dieser Handlungsweise einsieht. Man entdeckt bei sich selbst einen Vorteil, einen höheren Nutzen darin, moralisch zu handeln. Damit wird aber vorausgesetzt: Wer moralisch handelt, der erfährt in seinem Leben ein höheres Glück, einen größeren Nutzen.
Nun möchte ich Letzteres keineswegs bestreiten, im Gegenteil. Doch von Pascal wird die Moral für etwas anderes funktionalisiert. Moralische Werte sind aus Vernunftgründen nicht direkt erkennbar. Sie erhalten ihren Sinn, ihren Wert durch die Funktion, die sie erfüllen. Hier verfällt Pascals Argument jener Kritik, die ich in Kapitel 2.5 noch genauer darstellen werde. Pascals Grundgedanke lautet also: Wer auf Gott wettet, der kann nur gewinnen. Aus dieser Überzeugung auch moralisch zu handeln ist nur ein Teil der Wette und darin nur ein Nebenprodukt. Moral hat hier keinen Eigenwert.
Doch Pascals Argument leidet an einem fundamentalen Denkfehler: Er setzt voraus, dass es nur eine Offenbarung Gottes gibt. Wenn man sich für den Islam entscheidet und Christen als Ungläubige bekämpft, vielleicht sogar (wie zitiert) tötet, dann wird man ewig verdammt, falls der christliche der wahre Glaube ist. Ist der Islam dagegen die wahre Offenbarung, dann gewährt der andere Gott (Allah) einem ewige Freuden im Paradies. Der Wahrscheinlichkeit einer unendlichen Seligkeit aus einem Glauben stehen also als »Kosten« nicht nur gegenüber, sich moralisch verhalten zu müssen. Es besteht prinzipiell die durchaus nicht kleine Wahrscheinlichkeit, dass man den falschen Glauben gewählt hat und dafür eine unendliche Strafe erleidet. Es stehen sich also zwei unendliche Größen zur Abwägung gegenüber. Eine rationale Entscheidung für einen Glauben kann nicht mehr getroffen werden.
Pascals Wette ist eine Illusion. Mehr noch: Gott sieht nach dem Zeugnis vieler religiöser Texte gar nicht die äußere Handlung als moralisch relevant an, sondern ausschließlich die Motivation des Handelns – man vergleiche das berühmte »Scherflein der Witwe« (Markus 12,41-44). Wer dann aus reinem Wettkalkül Nutzen und Kosten abwägt und nur den äußeren Anschein eines moralischen Handelns praktiziert, der kann sich in dieser Perspektive gerade umso mehr versündigen: Er hat dann aus einer berechnenden Haltung äußerlich moralisch gehandelt, während seine Motivation reine Gier nach Seligkeit war. Aus Pascals Wette ist deshalb nur ein Gedanke mitzunehmen: Durch eine berechnende Haltung kann man weder »die richtige Offenbarung« auswählen noch kann man sicher sein, dadurch spirituell überhaupt etwas zu erreichen.
Implizit formuliert Pascal eine funktionale Moral die man so beschreiben kann: Wenn man den bloßen Anschein der Moral seinem Handeln zugrunde legt, so wird man die natürliche Disposition zum Moralischen in sich aufwecken, darin geläutert und das Glück in der Moral selbst finden. Voraussetzung für dieses Argument ist aber eine Annahme, die so lautet: ›Menschen wollen glücklich sein; wahres Glück findet man aber nur im moralischen Handeln.‹ Wenn man diese Regeln zunächst gleichsam nur experimentell übernimmt, so wird sich dennoch früher oder später die Erfahrung des darin liegenden Glücks einstellen. Man kann diese These auch bezüglich des sozialen Aspekts der Ethik so formulieren: Auch wenn jemand ohne innere Überzeugung moralisch handelt, so erfüllt sein Handeln sozial, für die Gesellschaft eine nützliche Funktion. Solch ein Handeln ist dann zwar nicht tugendethisch motiviert, aber durch seine äußere Wirkung dennoch objektiv moralisch. Die Kant’sche Pflichtethik kann man in diesem Sinne interpretieren. Auch Kant meinte, dass man auch gegen eigene Leidenschaften und Empfindungen moralische Regeln einfach aus Vernunftgründen als eine Pflicht betrachtet. Hier zeigt sich, dass der Versuch, durch ein rationales Kalkül einen Gottesglauben begründen zu wollen, zwar gründlich schiefgeht, die Begründungsweise gleichwohl Fragestellungen offenbart, die sich auch für die Diskussion einer säkularen Ethik als hilfreich erweisen. Die Pascal’sche Wette kann aber das entscheidende Dilemma nicht auflösen: Welche Offenbarung soll ich wählen? Soll ich überhaupt an eine Offenbarung glauben?
Nun haben Theologen oder Philosophen auch abseits von Pascals Kalkül mit der ewigen Seligkeit versucht, dennoch einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden. Dieser Ausweg besteht immer darin, dass man über der Offenbarung eine allen Menschen gemeinsame Vernunft akzeptiert, dass man also die Philosophie als Vernunftwissenschaft vor jedem religiösen Bekenntnis anerkennt. Averroes, einer der wichtigsten Philosophen im Islam, argumentierte durchaus auf diese Weise: Er sagt sinngemäß, dass die religiösen Aussagen alle durch die Philosophie begründet werden könnten; der Koran mit seinen Bildern und Geschichten sei für »die breite Masse«, die keinen Zugang zur Philosophie habe.{41} Die christlichen Philosophen gingen nicht so weit – und falls doch, wurden sie oft als Ketzer verdammt. Sie anerkannten aber dennoch durchaus die Autorität der Philosophie, seit dem 13. Jahrhundert vor allem die des Aristoteles. Damit fanden in theistischen Systemen für die Moralbegründung philosophische Argumente der griechischen Tradition Eingang und eröffneten so auf längere Sicht doch eine Verständigungsmöglichkeit. Ramon Lull hat um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert sogar ein logisches System entwickelt, das alle religiösen Aussagen der theistischen Systeme beinhalten sollte, und sie so in ein Gespräch miteinander gebracht.{42} Nikolaus von Kues knüpfte daran an und versuchte sich gleichfalls an einem interreligiösen Diskurs auf philosophischer Grundlage.{43} Die Mystiker – jüdische, christliche und islamische – gingen noch einen anderen Weg. Sie bauten zwar auf der je eigenen Religion auf, vertraten aber die Auffassung, dass man durch mystische Praktiken auch direkten Zugang zu Gott, zu einer Gotteserfahrung gewinnen und aus solch einer Erfahrung selbst erkennen könne, was moralisch richtig oder falsch sei.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Säkulare Ethik»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Säkulare Ethik» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Säkulare Ethik» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.