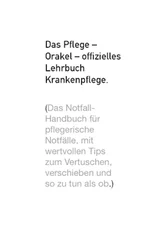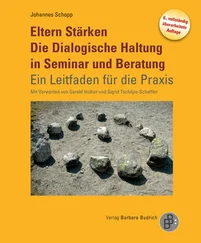Konzepte systemischen Arbeitens und auch systemischer Psychotherapie sind daher deutlich mehr im Bereich der Beratung zu finden – der bisher dem Zugriff von WBP und G-BA entzogen blieb und daher nicht unter ihren desaströsen Ausgrenzungsstrategien leiden muss. Hier gibt es in der Tat viele Ausbildungsgänge zum Berater, aber z. B. auch zum klinischen Sozialarbeiter und zu anderen Berufsbildern, in denen Konzepte systemischer Therapie in reiner Form oder (vor allem) in mit anderen Konzepten gemischter bzw. integrierter Form vermittelt werden. Offiziell ist zwar sehr klar geregelt, was in Deutschland »Psychotherapie« heißen darf. Aber faktisch wird eben auch in Beratungsstellen sowie auf dem privaten Sektor vieles angeboten, was sich mit Psychotherapie überlappt (aber aus juristischen Gründen anders genannt werden muss). Allerdings sind hier eben auch die Zugänge nicht vorwiegend auf Psychologen beschränkt, sodass Menschen mit einem breiten Spektrum an anderen akademischen Ausbildungen oder anderen Grundberufen solche Ausbildungen durchlaufen. Daher ist auch hier der Anteil von Psychologen klein.
Größer ist der Anteil von Psychologen in systemischen Aus-, Fort- und Weiterbildungen in einem anderen Bereich, nämlich dem Coaching. Auch hier gibt es in Sonderfällen und bei Einzel-Coaching Überlappungen mit psychotherapeutischer Tätigkeit. Aber ganz überwiegend liegen beim Coaching der Problemfokus und der Arbeitsschwerpunkt doch deutlich anders als in der Psychotherapie oder der Beratung – weshalb Coaching für unsere Fragestellung nach dem Stellenwert der Psychologie für »systemische Therapie und Beratung« hier nicht weiter betrachtet werden soll.
Die (noch) sehr geringe Offenheit der Psychologie für systemische Konzepte und ihre praktische Umsetzung in Psychotherapie und Beratung sowie auch für die psychologische Grundlagenforschung ist umso bemerkenswerter, als mit der Gestaltpsychologie der Berliner und Frankfurter Schule – Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler, Kurt Lewin, Kurt Goldstein – zwischen 1910 und 1935 eine international beachtete Richtung der Psychologie grundlegende Ansätze entwickelte, die auch in der heutigen Systemtheorie bedeutsam sind. So entwarf Goldstein auf der Basis umfangreicher Untersuchungen an hirnverletzten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg sein zentrales Konzept der »Selbstaktualisierung« (Goldstein 1934). Damit ist die Realisierung und Entfaltung inhärenter Potenziale gemeint, wobei aber diese inneren Möglichkeiten stets mit den äußeren Gegebenheiten dynamisch zu einer ganzheitlichen Gestalt abgestimmt werden. Veränderung dieser dynamischen Ordnung wird von ihm als eine Reorganisation einer alten Struktur (»pattern«) zu einer neuen und effektiveren Struktur beschrieben. Dies entspricht weitgehend den Konzepten, die heute in der interdisziplinären Systemtheorie (vgl. »Synergetik«, Abschn. 1.3.11) und der entsprechenden systemischen Therapie (vgl. »Personzentrierte Systemtheorie«, Abschn. 1.3.12) mit Selbstorganisation, Attraktoren und Ordnungs-Ordnungs-Übergängen (bzw. Phasenübergängen) thematisiert werden und aktuell sind.
Doch auch die Gestaltpsychologie ist in Deutschland marginalisiert: Im »Dritten Reich« mussten die meisten Wissenschaftler emigrieren, da sie Juden waren und zudem ihre Betonung von ganzheitlicher, autonomer Organisation, sich selbst herausbildenden Ordnungen und freiheitlich-schöpferischer Kreativität konträr zur Nazi-Ideologie mit ihren autoritär-diktatorischen Strukturen, der Fremdbestimmung und der einfachen Ursache-Wirkungs-Effekte stand. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren dann zwar Deutschland und (wenige) Nazi-»Führer« besiegt, nicht aber (so schnell) diese Ideologie. Es ist daher nachvollziehbar, dass eine größere Kontinuität im Behaviorismus gefunden wurde – und man sich dabei sogar mit den »Siegern« identifizieren konnte –, anstatt sich auf »unvölkische« Konzepte der Gestalttheorie zurückzubesinnen. Zumindest mag dies den rasanten Aufstieg behavioraler Konzepte und die weitgehende Ignoranz gegenüber gestaltpsychologischen und systemischen Ansätzen mit erklären.
Wegen der oben erwähnten starken Orientierung der Psychologie am experimentellen Paradigma gilt diese Abstinenz der Psychologie bezüglich der Teilnahme an systemischen Diskursen auch für einen anderen Strang der Systemtheorie, die mit dem Konzept der »Autopoiese« wesentlich auf den Soziologen Luhmann zurückgeht (vgl. Abschn. 1.3.5und 1.3.6). Indem sich die Psychologie in ihrem Mainstream nämlich deutlich von der Sozialwissenschaft distanziert und gerne als »Naturwissenschaft« gelten möchte (ohne deren Entwicklung in den letzten Jahrzehnten wirklich zu beachten), spielt auch dieser Autopoiese-Ansatz viel mehr in Sozialwissenschaft, Pädagogik und Sozialpädagogik sowie anderen Kultur- und Gesellschaftswissenschaften eine Rolle. Für die Psychologie bleibt hingegen auch dieser Ansatz weitgehend irrelevant.
1.2.2Das systembiologische Paradigma in der Medizin
Felix Tretter
Das biopsychosoziale Rahmenmodell der Medizin
Seit den 1970er-Jahren steht die medizinische Forschung stark unter dem Einfluss des »biopsychosozialen Modells«, eines mehrdimensionalen integrativen Rahmenkonzepts (Engel 1977). Es erklärt das Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Faktoren in Gesundheit und Krankheit. Die Kausalanalyse erfolgt systemisch, d. h. mit Blick auf mehrere Organisationsebenen des Menschen: Moleküle, Zellen, Organe, Organismen, Familie, Gesellschaft etc. (Egger 2005). Dieses Modell dient als Leitkonzept zur Gestaltung psychosozialer Hilfen. Allerdings dominiert seit den 1990er-Jahren die biologische Perspektive, bedingt durch die Entwicklung neuer molekularbiologischer Methoden. Heute sind materialistische Konzepte verbreitet, die sowohl das »Psychische« wie auch das »Soziale« neurobiologisch erklären wollen. Dies mündet im Bild des hirnzentrierten »Homo neurobiologicus«. Als Gegenmodell wird im Folgenden die systemische Medizin bzw. Psychosomatik dargestellt (vgl. Tretter 1989; Ahn et al. 2006a, b).
Molekulare Medizin – Vom Genom über die Epigenetik zur molekularen Systembiologie
Die molekulare Medizin geht davon aus, dass Gene und/oder Proteine als »Generatoren« von Krankheit identifiziert und entsprechende molekulare Interventionen, vor allem durch Pharmaka, entwickelt werden können (Ganten u. Ruckpaul 2008). Insbesondere Rezeptoren und Transporter für Glukose (Diabetes), Cortisol (Depression) etc. sind im Fokus. Es ist in dieser Hinsicht von »personalisierter Medizin« die Rede, die das individuelle Genom als Basis von Gesundheit und Krankheit sieht (Collins 2010). Die Idee, dass bestimmte Gene alleine die organismischen Phänomene dirigieren, wäre allerdings zu einseitig. Die heute sehr populäre »Epigenetik« betont, dass die Gene unter der Kontrolle von Transkriptionsfaktoren stehen, die ihre direkten Aktivierungen und Deaktivierungen bewirken. Dadurch wird unter anderem die funktionelle Identität und Spezialfunktion in der Entwicklung einer Zelle festgelegt. Dieses Aktivierungsmuster wird von Umwelteinflüssen moduliert und kann bei Zellteilungen »vererbt« werden (Spork 2010; Michels 2011).
Dieses Verständnis intrazellulärer Regelkreise wird ergänzt durch die Erkenntnis, dass molekulare Kaskaden der Signaltransduktion vom Rezeptor bis zu phosphorylierenden und desphosphorylierenden Enzymen Transkriptionsfaktoren aktivieren oder deaktivieren können. Diese molekularen Signalketten zeigen ihrerseits Rückkopplungen, Vorwärtsschaltungen und Wechselwirkungen, sodass nur schwer ohne Computersimulationen verstanden werden kann, welche Folgen Rezeptoraktivierungen oder -blockaden haben. Dieses Bild der Zelle als biochemischen Netzwerks macht auch verständlich, was auf statistischer Ebene als »Komorbidität« klassifiziert wird: Komorbidität etwa von Diabetes und Depression bzw. Herzinfarkt und Depression dürfte auf gemeinsamen inter- und intrazellulären molekularen Signalbahnen von Hormonen (z. B. Cortisol) bzw. Immunfaktoren (z. B. Zytokine) beruhen.
Читать дальше