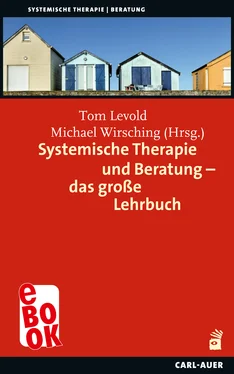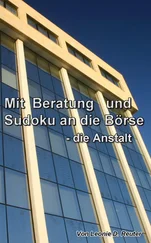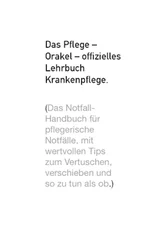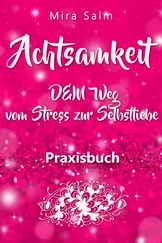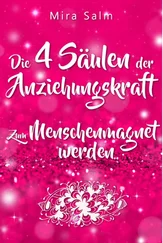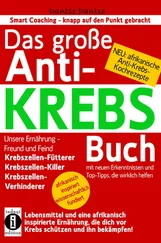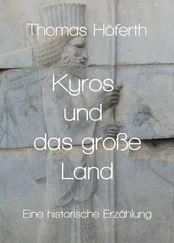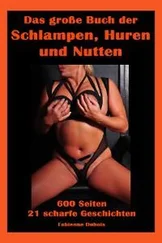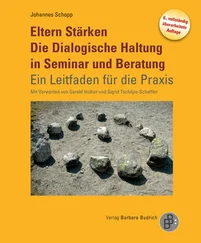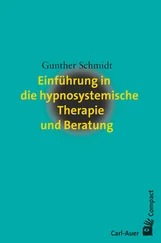Nicht viel anders ist der für die berufsrechtliche Anerkennung gutachtende »Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie« (WBP) ausgerichtet. Der vom Gesetzgeber geforderte Nachweis für zuzulassende Verfahren, dass es sich um »wissenschaftlich anerkannte Verfahren« handeln müsse, wurde gleich nach Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes vom WBP dahin gehend ausgelegt, dass es ausschließlich um nachgewiesene Wirksamkeit im Rahmen eines klassisch linearen Input-Output-Wirkmodells unter experimentellen Bedingungen geht (im Wesentlichen um randomisierte, kontrollierte Studien). Während aber zumindest noch in der ersten Amtsperiode (2000–2004) die Wirksamkeitsstudien als exemplarisch angesehen wurden, d. h. bei hinreichend großer Bandbreite der Anwendungsbereiche als Belege für die Wirksamkeit eines Verfahrens gewertet wurden, verschärfte und verengte der WBP in seiner zweiten Amtsperiode (2005–2009) die Medikalisierung der Psychotherapie insofern, als nun für jeden Störungsbereich jeweils spezifische Wirksamkeitsbeweise vorgelegt werden müssen (wobei zumindest noch beibehalten wurde, dass ein Verfahren auch dann anerkannt werden kann, wenn ein bestimmtes Mindestmaß an Bereichen abgedeckt ist).
Bei einem solchen Vorgehen wird zwangsläufig unterstellt, dass die eigentlich auf Symptomklassifizierung ausgelegten Diagnosesysteme psychisch-interpersoneller Beschwerden so etwas bedeuten wie reine Bakterienstämme in der Medizin (Kriz 2010a): Ein Bakterium b kann dabei forschungslogisch als Repräsentant eines allgemeinen Bakterienstammes B mit denselben Eigenschaften für alle Mitglieder angesehen werden; und diese können daher auch mit dem Antibiotikum A – das an ganz anderen individuellen Mitgliedern von B irgendwo auf der Erde in einem Labor erprobt wurde – bekämpft werden. Wenn dazu noch ein zusätzliches relevantes Bakterium C mit anderen symptomatischen Wirkungen kommt, so würde man sinnvoll von »Komorbidität« sprechen und das gegen C entwickelte Antibiotikum ebenfalls verabreichen. Ein als »Depression« klassifiziertes Beschwerdebild eines Menschen kann aber schwerlich als Repräsentant einer Klasse D angesehen werden. Und eine weitere Diagnosekategorie – z. B. Belastungsstörung – macht aus diesem Menschen keinen komorbiden Patienten mit zwei Krankheiten. Vielmehr lässt sich sein – individuelles – komplexes Beschwerdebild nur mit zwei (oder gar mehr) Kategorien beschreiben bzw. erfassen. Das ist etwas grundlegend anderes. Weder gegen D noch gegen die »komorbide« Mischung lässt sich ein Wirkmittel in Form von Psychotherapie verabreichen, das wie Pharmarezepturen irgendwo in der Welt im Labor entwickelt wurde – und bei dem es egal ist, unter welchen sozialen oder kulturellen Kontexten man es erprobt hat.
Die stillschweigende Gleichsetzung beider Vorgänge, nur damit eine bestimmte im Medizinsektor (für einfache Krankheiten) hinreichend erfolgreiche Methodik einem völlig andersgearteten Ausschnitt von Wirklichkeit übergestülpt werden kann, sollte eigentlich für alle methodisch hinreichend Gebildeten überaus fragwürdig erscheinen. Dass dies dennoch so bedenkenlos vom großen Mainstream getragen wird, zeugt von der großen Faszination des medizinischen Modells. Denn es ist wohl nicht allein das Motiv berufspolitischer Konkurrenz, welches den G-BA und den WBP beflügelt. Allzu viele Therapeuten haben sich gut mit der Selbstdefinition arrangiert, dass sie objektiv diagnostizierbare Krankheiten bzw. Störungen mit ebenso objektiv definierbaren Methoden behandeln, die sie, wie in der Schulmedizin, in bestimmten Dosen, mit bestimmter Frequenz und entsprechend einer evidenzbasierten Standardprozedur verabreichen können. Zudem unterstützt die üblicherweise mangelhafte wissenschaftstheoretische Reflexion sowohl im Psychologie- wie im Medizinstudium einen fast mystisch-magischen Glauben in die scheinbare Objektivität von quantitativen Daten und ihrer computertechnischen Verarbeitung – nahezu egal, wie diese Daten zustande gekommen sind. Die Fiktion einer Weltbeschreibung, in welcher der Beschreibende scheinbar nicht vorkommt, sondern nur »Fakten« einsammelt, ist leider gerade unter Klinikern verbreitet – auch wenn dieses Weltbild in den Naturwissenschaften bereits seit rund einem Jahrhundert als überwunden gilt. All dies nährt die Medikalisierung psychosozialer Prozesse und Zusammenhänge.
Für die systemische Therapie folgt daraus allerdings, dass sie sich notwendig im Bereich ambulanter Psychotherapie in der BRD den Erfordernissen eines Systems anpassen muss, dessen Machtstrukturen auch der Psychotherapie einseitige, medikalisierte Vorstellungen von Wirksamkeit und ihrer Nachweismethodiken sowie ein entsprechendes Menschen- und Weltbild oktroyieren. Andernfalls riskiert die systemische Therapie, weiter ausgegrenzt und marginalisiert zu werden. Gleichzeitig ist es wichtig, diese Zwangsverordnung eines homogenen Glaubenssystems – das zudem gemäß der Entwicklung der modernen Naturwissenschaften auch noch größtenteils inadäquat und antiquiert ist – immer wieder in allen Kontexten nach Möglichkeit zu kritisieren. Zudem gilt es zu bedenken, dass der Bereich »Psychotherapie« im formalen Sinn, der so rigide auch nur in Deutschland geregelt wird, einen vergleichsweise kleinen Bereich im großen Spektrum systemischer Anwendungsfelder ausmacht. Dies könnte zu einer hinreichenden Gelassenheit beitragen.
Für den Umgang mit den Menschen, die in der gegenwärtigen Kultur der Medikalisierung leben und um professionelle Hilfe von Systemikern bitten, ist die Beachtung der unterschiedlichen Erwartungsstrukturen wichtig. Denn gerade auch der Volksglauben hat medikalisierte Vorstellungen und Reparaturmodelle für psychosoziale Prozesse in hohem Ausmaß übernommen. Da systemische Therapie aber ohnedies zentral mit der Dekonstruktion pathogener, einengender und destruktiver »Wahrheiten« arbeitet, sollte dies kein besonderes Hindernis für konstruktives Arbeiten sein.
1.2Berufliche Zugänge
1.2.1Psychologie
Jürgen Kriz
Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland die meisten niedergelassenen Psychotherapeuten und ein großer Teil professioneller Berater ein Psychologiestudium absolviert haben, ist der Einfluss von Psychologie und akademisch ausgebildeten Psychologen auf die systemische Therapie und Beratung recht gering. Das gilt, soweit Ausbildungsgänge und Berufsstrukturen überhaupt vergleichbar sind, auch für andere Länder. Psychologie ist somit kein besonders guter Zugang zur systemtherapeutischen Praxis – nicht einmal ein durchschnittlich guter.
Für diese Unterrepräsentation von Psychologie im Bereich systemischer Profession gibt es zwei zentrale Gründe: Zum einen ist der Mainstream akademischer Psychologie vor allem mit solchen Befunden verbunden, welche dem klassischen experimentellen Paradigma entsprechen – wozu insbesondere die klare Differenzierung in unabhängige und abhängige Variablen, die Nichtbeachtung oder Ausschaltung von Rückkopplungseffekten und nichtlinearen Verläufen sowie die Anpassung an Designs nach dem »allgemeinen linearen Modell« (u. a. Varianzanalyse, Faktorenanalyse, Pfadanalysen etc.) gehören. Phänomene von Selbstorganisation, qualitative Sprünge und Nichtlinearitäten oder die Beachtung von Effekten in rückgekoppelten Netzwerken spielen somit praktisch keine Rolle. Gleichzeitig ist der Druck auf akademische Karrieren in der Psychologie aber groß, möglichst experimentell zu arbeiten, sodass auch theoretische und praxeologische Arbeiten in der Psychologie eher marginalisiert sind, während solche Werke in anderen Disziplinen, z. B. in den Sozialwissenschaften oder in der Pädagogik, dazu beitragen, dass systemisches Denken in die Diskurse einbezogen und verbreitet wird.
Der zweite, damit verknüpfte Grund ist, dass auch die psychotherapeutischen Arbeitsfelder – zumindest unter den gesundheitsadministrativen Bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland – vom behavioralen Mainstream beherrscht werden. Und dies sogar mit steigender Tendenz: Fast alle deutschen Lehrstühle in Klinischer Psychologie und Psychotherapie an den Universitäten sind mit Vertretern des verhaltenstherapeutischen Paradigmas besetzt; Studierende erfahren kaum noch, dass es überhaupt andere Ansätze, Zugänge und Paradigmen gibt. Zunehmend werden daher nur noch behaviorale Ausbildungsgänge zum Psychotherapeuten nachgefragt. Durch eine extrem aufwendige Prozedur für die Zulassung weiterer Verfahren, verbunden mit einer Doppelhürde aus »Wissenschaftlichem Beirat Psychotherapie (WBP)« und »Gemeinsamem Bundesausschuss (G-BA)«, ist es den Vertretern der beiden Richtlinienverfahren gelungen, auch zwölf Jahre nach Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes kein einziges weiteres Verfahren zuzulassen – und daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Denn nachdem der WBP rund ein Jahrzehnt gebraucht hat, um die systemische Therapie berufsrechtlich anzuerkennen, sind schon wieder mehrere Jahre ins Land gegangen, ohne dass der G-BA überhaupt das notwendige Prüfverfahren für die sozialrechtliche Anerkennung auch nur in Gang gesetzt hätte. Es kann also niemand auf der Basis der inzwischen in ihrer Wirksamkeit selbst in Deutschland formal vom WBP anerkannten systemischen Therapie auch niedergelassener Therapeut werden. Erste Aufweichungstendenzen sind zwar beobachtbar, indem über Weiterbildungsgänge zusammen mit einer Approbation in einem der Richtlinienverfahren auch ein Zusatztitel in systemischer Therapie erworben werden kann, aber dies sind erste Modellversuche mit erheblichen zusätzlichen Kosten der ohnedies sehr teuren Ausbildung zum Psychotherapeuten. Quantitativ fällt dies (noch) nicht ins Gewicht.
Читать дальше