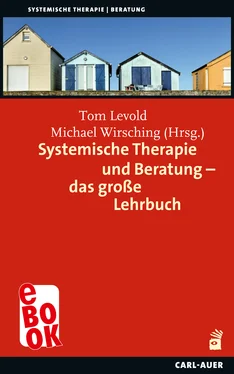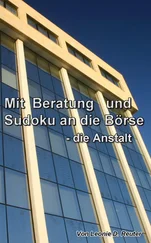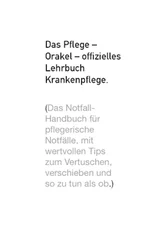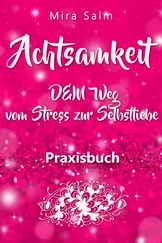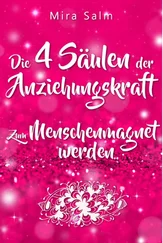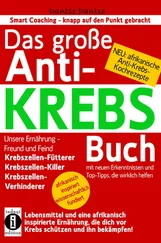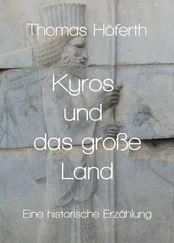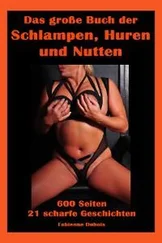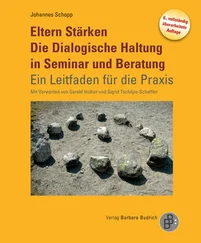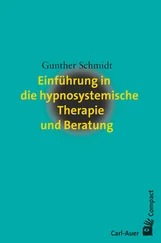1 ...7 8 9 11 12 13 ...41 Das systemtheoretisch-konstruktivistische Konzept stützt sich auf die Rezeption der Theorie sozialer Systeme Niklas Luhmanns, die im vergangenen Jahrzehnt eine starke Position im Diskurs der Sozialen Arbeit eingenommen hat (vgl. Abschn. 1.2.4und 1.3.6). Soziale Arbeit wird als autonomes gesellschaftliches Funktionssystem gesehen, das als autopoietisches System selbstorganisiert dem Code »Hilfe vs. Nichthilfe« folgt und nach Maßgabe eigener, systeminterner Hilfe-»Programme« operiert. Den Wirklichkeitskonstruktionen des Hilfesystems stehen die Konstruktionen der Klientensysteme gegenüber. Der Erfolg konkreter Hilfeprozesse ist daran gebunden, dass hier eine »strukturelle Koppelung« der verschiedenen Systeme gelingt, was am ehesten durch eine strikte Ressourcenorientierung erreicht werden kann (Kleve 2003; Hosemann u. Geiling 2005).
Im Zentrum des systemisch-entwicklungsorientierten Konzepts steht die von Rogers und Satir vertretene prinzipielle Entwicklungsoffenheit des Individuums mit dem – konzeptuell vorgegebenen – Entwicklungsziel einer größtmöglichen Kongruenz des Selbst (»Authentizität«) und seiner Selbstverantwortung. Entscheidend ist dabei der sichere Selbstwert in den Beziehungen zwischen dem Selbst und seinen sozialen anderen. Soziale Arbeit hat die Aufgabe, das Subjekt dabei zu unterstützen, internale und externale Barrieren gegen dieses Ziel zu überwinden (Germain u. Gitterman 1999).
All diese unterschiedlichen Richtungen treffen sich im Begriff des Systems, das als Denkmodell unterschiedliche Facetten von Wirklichkeitswahrnehmungen, Bedeutungszuschreibungen und sozialen Strukturen zu integrieren vermag (Ritscher 2012, S. 28 ff.).
Aus den vorgestellten theoretischen Modellen lassen sich vier zentrale Aufgabenbereiche einer systemischen Sozialen Arbeit ableiten. Das Unterstützungssystem (Ritscher 2007) besteht aus den Adressatinnen, den Fachkräften und anderen involvierten Faktoren in einem Setting gemeinsamer Auftrags- und Zielklärung, Problembeschreibungen und Problemlösungsversuche. Die Kontextualisierung aller Ereignis-, Beziehungs- und Problembeschreibungen (Ritscher 2012, S. 254) ergibt sich aus der System-Kontext-Struktur. Die Moderationsfunktion Sozialer Arbeit in sozialen Netzwerken nimmt die Abgrenzung unterschiedlicher Unterstützungssysteme und ihrer Kooperation in den Blick (Ritscher 2007, S. 59 ff.), und aus dem gesellschaftlichen Unterstützungsauftrag Sozialer Arbeit ergibt sich ein auch politisch verstandenes Engagement für sozial benachteiligte Personen und Gruppen.
Daraus ergeben sich Anforderungen an eine ethisch und theoretisch begründete Haltung, an Konzepte für Settinggestaltung, Diagnose, Intervention und Evaluation und die Entwicklung dafür hilfreicher Methoden. Die Haltung ist durch Allparteilichkeit, Interesse, Neugier, Respekt und eine Ressourcenstatt Defizitorientierung gekennzeichnet. Bezüglich der Sozialarbeiterinnen selbst zeichnet sie sich durch eine stete Reflexion der persönlichen Hilfemotive, ihres gesellschaftlichen Auftrags und der Akzeptanz des unauflösbaren Widerspruchs zwischen Wirksamkeitsinteresse und »nichtinstruktiver Interaktion« aus. Hinsichtlich des Hilfesystems geht es um Kooperation, Akzeptanz wechselseitiger Abhängigkeit und »Hilfe zur Selbsthilfe«. Letzteres Konzept enthält grundlegende Forderungen Sozialer Arbeit nach Transparenz, Partizipation und Empowerment (Germain u. Gitterman 1999). Diagnose und Intervention sind zwei Seiten des systemischen Handelns (Ritscher 2004) und gestalten sich in der Struktur von »Angebot« (Stichwort: Freiwilligkeit), »Eingriff« (Stichwort: Zwangskontext) und »gemeinsamem Handeln« (Stichwort: Kooperation; vgl. Müller 2012).
Jenseits einer durch den gesellschaftlichen Mainstream beförderten lösungsorientierten Perspektive muss betont werden, dass es nicht immer Lösungen geben kann, mit denen sich Soziale Arbeit überflüssig macht. Es gibt Fälle langfristiger oder lebenslanger Begleitung, bei denen es mehr um eine begrenzte Sicherung des Alltags als um strukturelle Veränderungen geht. Damit ist eine Gratwanderung zwischen der Gefahr einer professionell erzeugten Chronifizierung einerseits und der Akzeptanz begrenzter Ressourcen für die Alltagsbewältigung andererseits verbunden.
1.2.4Sozialwissenschaften
Tom Levold
Mehr als bei anderen psychotherapeutischen Schulen bzw. Grundorientierungen hat sozialwissenschaftliches Denken in der systemischen Therapie und Beratung große Bedeutung.
Das dabei implizit und explizit herangezogene sozialwissenschaftliche Spektrum umfasst über die Soziologie hinaus eine Vielzahl von Disziplinen, so z. B. Sozial- und Kulturanthropologie, Ethnologie, Kommunikations- und Medienwissenschaften, Kulturwissenschaften, Linguistik, Sozialmedizin, Sozialgeschichte usw. All diese unterschiedlichen Ansätze teilen eine soziologische bzw. sozialtheoretische, wenn auch nicht unbedingt systemtheoretische Perspektive und untersuchen ihren jeweiligen Gegenstandsbereich als ein Feld sozial, d. h. interaktiv und kommunikativ konstituierter Phänomene.
Für den systemischen Ansatz sind die Aspekte der empirischen Sozialforschung, der systemtheoretischen Sozialtheorie und der klinischen Soziologie von Bedeutung.
Empirische Sozialforschung
Als Gesellschaftswissenschaft hat sich die Soziologie von Beginn an mit dem Vorkommen und der Verteilung sozialer Probleme ebenso wie mit ihrer Behandlung durch die Politik und andere gesellschaftliche Institutionen beschäftigt. Unterdisziplinen wie die Familiensoziologie, die Medizinsoziologie, Soziologe der Kindheit u. a. haben eine Vielzahl von Befunden über soziale Lebenslagen erhoben, die auch für psychotherapeutische Kontexte von Belang sind.
Bemerkenswerterweise spielen aber diese Spezialdisziplinen für die Familientherapie ebenso wie für die systemische Therapie nur eine kleine Rolle (Morgan 1988). Auch wenn die einschlägigen Zeitschriften immer wieder Aufsätze oder auch Themenhefte publizieren, die dem sozialen Wandel individueller und kollektiver Lebensweisen als Kontext für die Entwicklung und Veränderung therapierelevanter sozialer Probleme gewidmet sind, lässt sich nicht von einer systematischen Verbindung zwischen Familientherapie und Familiensoziologie reden. Ein möglicher Grund könnte in der lange gehegten normativen Tradition familiensoziologischen Denkens liegen (z. B. bei Parsons; vgl. Bertram 2010), in der die Kleinfamilie als bewahrenswerte Keimzelle der Gesellschaft betrachtet wurde, während Familientherapeuten schon früh mit den Auflösungs- und Transformationsprozessen modernen Familienlebens konfrontiert waren. Zudem erwiesen sich die empirischen, eher an demografischen Fragestellungen orientierten Untersuchungen der Familiensoziologie meist nicht als besonders anschlussfähig für familientherapeutische Problemstellungen. Diese relative Fremdheit ist durchaus zu bedauern, da es in Hinblick auf den gemeinsamen Gegenstand familialer Lebenswelten durchaus einige »Schätze« zu bergen gilt (Kühl 2006, S. 14).
Größere Bedeutung als die nur unzureichend rezipierten Spezialdisziplinen erhielten in der Entwicklung der systemisch-konstruktivistischen Therapie und Beratung psychiatriekritische und grundlagentheoretische Konzepte der Soziologie, die eine Alternative zum vorherrschenden psychomedizinischen Paradigma (Cottone 1989) eröffneten. Dazu gehören mikrosoziologische Ansätze wie der symbolische Interaktionismus, der die Bedeutung von sozialen Objekten, Situationen und Beziehungen – und damit auch von psychischen Dispositionen und Problemen – nicht in ihnen selbst verortet, sondern ihre Hervorbringung in symbolisch vermittelten Interaktions- und Kommunikationsprozessen untersucht (vgl. Matthes u. Schütze 1973). Einflussreich waren hier auch u. a. Arbeiten von Scheff und Goffman über die Etikettierung problematischen Verhaltens als geisteskrank im Kontext psychiatrischer Diagnostik und organisationsspezifischer Interaktionsrituale in Kliniken (Goffman 1977; Scheff 1980). In einem berühmt gewordenen Experiment mit verdeckt operierenden »gesunden« Testpersonen in psychiatrischen Kliniken konnte Rosenhan zeigen, dass keine dieser Personen als gesund erkannt, sondern alle psychiatrisch diagnostiziert wurden (1973). Diese Studien entzaubern die Vorstellung von Krankheit als Wesensmerkmal und analysieren sie als soziale Konstruktion, die eine bestimmte Funktion für das betreffende Sozialsystem (z. B. der Familie) erfüllt und mit entsprechenden Rollenanforderungen für Patienten und Therapeuten im Gesundheitssystem einhergeht (Parsons u. Fox 1952).
Читать дальше