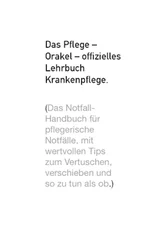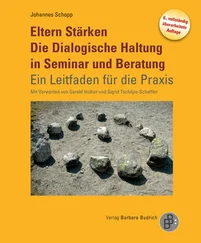Profession und (De-)Professionalisierung
Lehrbücher weisen auf einen gewissen Professionalisierungsgrad eines Fachgebietes hin. Einer Profession anzugehören oder eine Tätigkeit professionell zu verrichten gehört zu den Mindestansprüchen beruflicher Praxis im Bereich Therapie und Beratung und wird auch von denjenigen, die in diesen Bereichen Hilfen in Anspruch nehmen, erwartet. Neben dieser positiven Wertigkeit enthält der Begriff der Profession allerdings einige Unschärfen. Vor allem bezieht er sich nur bedingt auf die inhaltliche Güte von Tätigkeiten, sondern vielmehr auf den Grad der Organisiertheit von Wissen und Wissensträgern in der Gesellschaft.
Nicht jeder Beruf ist eine Profession. Professionen
»unterscheiden sich dadurch, dass sie die Berufsideen reflexiv handhaben, also das Wissen und das Ethos eines Berufs bewusst kultivieren, kodifizieren, vertexten und damit in die Form einer akademischen Lehrbarkeit überführen« (Stichweh 2006, S. 3).
Sie entstehen nicht durch Definition oder einen Gründungsakt, sondern in einem langwierigen Professionalisierungsprozess, der unterschiedliche Elemente aufweist: die Vereinigung derjenigen, die sich als Professionszugehörige verstehen; zunehmende Kontrolle in Bezug auf die Zulassung zu ihrem Tätigkeitsfeld über die Regelung von Approbationen, Zertifizierungen etc.; Durchsetzung von Vergütungsregelungen; Kontrolle von Aus- und Weiterbildung; Generierung und Monopolisierung von Wissensbeständen in Forschung und Lehre sowie ihre Veröffentlichung und Diskussion in Publikationen, auf Kongressen usw. (Abbott 1991). Damit einher geht die kontinuierliche Entwicklung und Differenzierung organisationaler Strukturen (das betrifft Berufsverbände, universitäre Fakultäten und andere Ausbildungsstätten, Kammern etc.).
Für Luhmann besteht das zentrale Merkmal von Professionen in der Arbeit an Personen,
»insbesondere von zu erziehenden, kranken, streitenden, trost- oder heilsbedürftigen« Personen bzw. solchen mit Verhaltensproblemen (Kurtz 2011, S. 35). Historisch schlossen die Professionen »das Wissen um die Beziehung des Menschen zu Gott ein (Theologie), weiterhin das Wissen des Menschen über sich selbst und seine physische Natur (Medizin) und schließlich das Wissen über die Beziehungen des Menschen zu anderen Menschen (Recht)« (Stichweh 2005, S. 1).
Privilegiertes Wissen, die starke ethische Bindung von Professionen (siehe den hippokratischen Eid, Dienstideale, die Gemeinwohlorientierung etc.) und die organisatorische Schließung gegenüber konkurrierenden Wissenssystemen führten dazu, dass wesentliche Bereiche des öffentlichen sozialen Lebens durch Professionen und Professionswissen reguliert wurden. Im 19. Jahrhundert wurde das Konzept der Profession auch auf neue akademische Berufe ausgedehnt (ebd., S. 2). Die Attraktivität dieser »alteuropäischen Professionssemantik« wirkt bis in die heutige Zeit hinein (man betrachte die entsprechenden Diskurse in der Sozialarbeit, den Pflegewissenschaften und der Supervision), obwohl das Prinzip der Professionalisierung schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts »eigentlich hätte als überholt erscheinen können« (ebd., S. 3). Dabei gelingt es nicht allen Berufsgruppen, alle genannten Merkmale von Professionen auch für sich zu erreichen. Insofern ist Professionalisierung auch ein relativer Begriff, Kühl spricht hier auch von Semiprofessionen (2006). Dabei wirft er die interessante Frage auf, ob wirklich alle Praxisfelder gut beraten sind, eine vollumfängliche Professionalisierung anzustreben, da sie immer auch mit einem Verlust an Freiheitsgraden einhergehe.
In den 40er- und 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts erreichte die Professionstheorie einen vorläufigen Höhepunkt mit der Arbeit des Soziologen Talcott Parsons, für den die Professionen eine zentrale Rolle bei der normativen Integration der Gesellschaft einnehmen, interessanterweise zu einem Zeitpunkt, als ihre gesellschaftliche Dominanz schon allmählich ins Wanken geriet. Gleichwohl trug seine Theorie im Sinne eines Reentrys zur Wiedererstarkung ihrer Bedeutung bei (vgl. Stichweh 2006). Einen wesentlich kritischeren Blick hat in den 1970er-Jahren Eliot Freidson mit seiner Konflikttheorie der Professionen, der zufolge es primär um strategische Konkurrenzkämpfe zur Sicherung von Einkommen, Status und Macht auf dem Arbeitsmarkt gehe (Freidson 2004; Brint 1993), eine Analyse, die gerade im Hinblick auf die Auseinandersetzungen um das Psychotherapeutengesetz hierzulande nicht von der Hand zu weisen ist.
Während für lange Zeit Entscheidungen und inhaltliche Strukturierung in vielen Arbeitsprozessen an die Figur des »Professionellen« als Inbegriff fachlicher Autorität gebunden war, löst sich dieser Zusammenhang allmählich zugunsten komplexer organisatorischer Bedingungszusammenhänge auf. Im Zuge der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Funktionssysteme verlieren nämlich hochgradig professionsgebundene Handlungsprogramme allmählich ihre Dominanz. Immer weniger Fachentscheidungen werden von einzelnen Professionellen nach eigener Maßgabe getroffen und verantwortet. Die Eigendynamik von Organisationen als Bezugsrahmen professioneller Praxis gewinnt immer mehr an Gewicht, auch wenn die berufliche Praxis in Organisationen immer noch von Abgrenzungskämpfen zwischen den in ihr tätigen Professionen geprägt ist.
Sieht man in der fachlichen Entscheidungsautonomie einen zentralen Aspekt professioneller Kompetenz, lässt sich beispielsweise seit Ende des 20. Jahrhunderts bei Ärzten ein schleichender, aber offenkundiger Deprofessionalisierungsprozess beobachten: Gleichzeitig mit einer enormen Vergrößerung der Wissensbasis findet eine zunehmende Verlagerung der Entscheidungskompetenz hin zu Kostenträgern (Krankenkassen und Rentenversicherungen) einerseits, zu den Patienten andererseits statt, die Mitte des Jahrhunderts noch unvorstellbar gewesen wäre (vgl. Vogd 2002). Auch die klassischen Zuständigkeitsgefechte der Berufsgruppen lassen sich in dem Maße weniger rechtfertigen, als organisationsbasiertes professionelles Handeln die kooperative Koordination an den Schnittstellen beruflicher Tätigkeiten zunehmend erforderlich macht.
Der systemische Ansatz als multiprofessionelles Projekt geht also über die Kommunikation zwischen einzelnen ständisch organisierten Berufsgruppen hinaus. Dieses Lehrbuch orientiert sich an einem Konzept professionellen Handelns als wissensbasierter, ethisch begründeter und verantworteter bzw. fachlich kontrollierter Praxis in unterschiedlichen Kontexten, die jedoch nicht mehr auf den Überlegenheits- oder Expertenstatus und die »Exklusivität professioneller Sonderwissensbestände« (Pfadenhauer 2003, S. 208) der klassischen Professionen zurückgreifen kann. Der Einsatz von und der Umgang mit Wissen bezieht sich daher immer auf die Handhabung von Ungewissheit, die für die Lösung praktischer professioneller Probleme konstitutiv ist.
Der amerikanische Wissenschaftssoziologe Donald Schön hat »reflection-in-action« als das Charakteristikum professioneller Praxis bezeichnet (Schön 1983). Situationen, denen sich Professionelle ausgesetzt sehen, sind (1) komplex, d. h. vieldeutig; (2) unsicher, da für jede Situation unterschiedliche Problemdefinitionen und Lösungsoptionen möglich sind; (3) instabil, da sie schnell wechseln und schnelle Neuorientierung hinsichtlich des eigenen Handelns erfordern; (4) einzigartig, da jede Situation eine spezifische historische, personale, zeitliche und materiale Konstellation darstellt, und (5) angewiesen auf Werteentscheidungen, durch die Kompatibilität mit eigenen Normen und Vorannahmen und denen der Umwelt hergestellt werden kann (vgl. Buchholz 1999, S. 194 f.). Professionelles Handeln ist keine Anwendung wissenschaftlichen Wissens auf die Praxis. Insofern ist »Psychotherapie ebenso wie Medizin keine Wissenschaft, sondern eine Profession, in deren Umwelt Wissenschaft vorkommt« (Reiter u. Steiner 1996, S. 159). Die Nichtberücksichtigung dieser Einsicht in der modernen Therapieforschung, die überwiegend einem objektivistischen, kausalen und reduktionistischen Paradigma folgt, dürfte mit dafür verantwortlich sein, dass sie von den Praktikern nicht rezipiert wird (Padberg 2012). Im Unterschied zur Medizin liegt die Aufgabe von Psychotherapie in der Bearbeitung eher vager Gegenstände (vgl. Fuchs 2011), nämlich komplexer Sinnfragen. Deren Vagheit ist eben gerade kein zu behebendes Defizit, sondern für die professionelle therapeutische Praxis konstitutiv.
Читать дальше