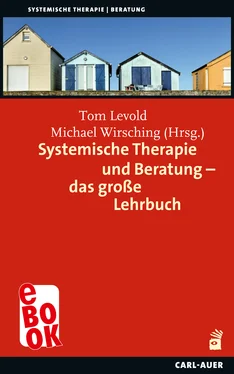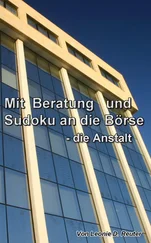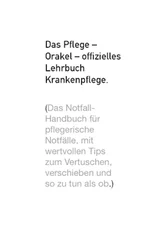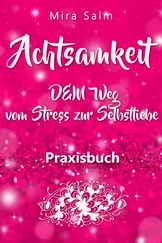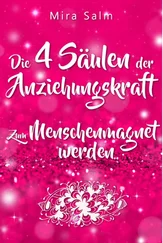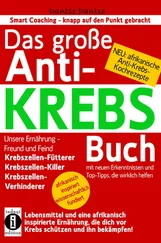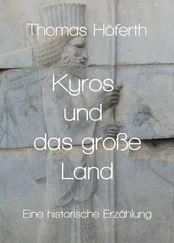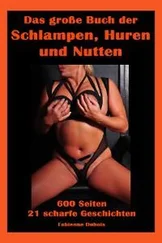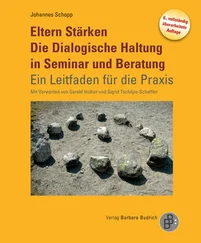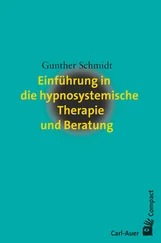Die »Ordnung des Wissens« des jeweiligen Fachgebietes zu vermitteln ist die primäre Aufgabe eines Lehrbuches. Es kann dazu beitragen, die professionelle Praxis zu legitimieren und zu orientieren. Viele Lehrbücher kommen deshalb mit einem Nimbus der Objektivität daher, mit dem ein Anspruch auf die Gültigkeit des präsentierten Wissens erhoben wird. Ein Wesensmerkmal der wissenschaftlichen Grundlegung des systemischen Ansatzes liegt jedoch darin, dass Wissen nicht als einheitlicher, widerspruchsfreier Kanon theoretischer und praxeologischer Konzepte, sondern als sich selbst ständig infrage stellende soziale und kommunikative Praxis verstanden wird, die sich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Facetten, Bezugnahmen und Entwicklungsrichtungen entfaltet. Dieses Lehrbuch postuliert daher nicht, was gilt oder gelten soll, sondern hat den Anspruch, die Vielfalt systemischen Denkens zugänglich zu machen. Gleichzeitig bietet es einen konzeptuellen Rahmen an, der Perspektivendifferenzen zwar ermöglicht, aber nicht der Beliebigkeit anheimstellt.
Ausgangspunkt ist ein Verständnis systemischer Therapie und Beratung als transdisziplinärer und multiprofessioneller Ansatz, ein Verständnis, das sich bewusst von der berufsständischen Einengung des psychotherapeutischen Professionalisierungsprozesses auf den »Psychologischen Psychotherapeuten« absetzt. Das Lehrbuch richtet sich daher gleichermaßen an psychologische und ärztliche Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie Angehörige anderer Berufe, die in therapeutischen Kontexten tätig sind.
Die Orientierung an Kontexten ist der Leitfaden, der sich durch das gesamte Buch zieht. Ausgehend von den unterschiedlichen beruflichen und disziplinären Zugängen zur systemischen Praxis, werden die verschiedenen theoretischen Kontexte vorgestellt, aus denen sich die Philosophie des systemischen Ansatzes speist.
Die Grundlagen der therapeutischen und beraterischen Praxis (Problemverständnis, Haltung, Methoden und Techniken) werden nicht wie oft üblich entlang medizinisch-psychiatrischer Diagnosesysteme entwickelt, sondern anhand konkreter Behandlungssettings und institutioneller und organisationaler Strukturen, innerhalb deren systemische Therapeutinnen und Berater tätig sind, und konkreter klinischer Konstellationen, die für spezifische Arbeitskontexte typisch sind.
Eigenständige Kapitel sind den Themen »Interkulturelle Therapie und Beratung« und »Ethik, Lehre und Forschung« gewidmet.
Als Herausgeber war es unsere Idee, die Vielfalt von Unterschieden innerhalb des systemischen Ansatzes durch die Beteiligung eines breiten Spektrums von Autorinnen und Autoren widerzuspiegeln, die über jahrelange Erfahrungen als Therapeutinnen und Berater wie auch als Lehrende in unterschiedlichen Kontexten verfügen. Mit einer einzigen Ausnahme haben alle Kolleginnen und Kollegen, bei denen wir wegen eines Beitrags angefragt haben, unsere Einladung angenommen. Ihnen gilt unser herzlicher Dank. Herausgekommen ist dabei ein repräsentativer Querschnitt dessen, was derzeit im systemischen Feld praktiziert und gelehrt wird. Zu Beginn der Arbeit an diesem Buch fand im März 2010 ein vom Carl-Auer Verlag organisiertes Treffen der Herausgeber und des Verlages mit einigen Autorinnen in Heidelberg statt, auf dem das Konzept des Lehrbuches diskutiert und viele Ideen für die weitere Arbeit auf den Weg gebracht wurden. Auch für diese Unterstützung möchten wir an dieser Stelle allen Beteiligten unseren Dank aussprechen. 2
Es wurde unter den Autoren eine lebhafte Diskussion darüber geführt, wie eine geschlechtssensitive Schreibweise umgesetzt werden könnte. Wie nicht anders zu erwarten, gab es eine Fülle von unterschiedlichen Vorschlägen, die sich nicht vereinheitlichen ließen. Als Herausgeber haben wir uns daher für eine Schreibweise entschieden, in der jeweils die männliche und weibliche Form in freiem Wechsel verwandt wird, wenn sich die Verwendung des Maskulinums oder Femininums nicht zwangsläufig aus dem Inhalt ergibt.
Tom Levold und Michael Wirsching Köln und Freiburg, Frühjahr 2014
1In den angelsächsischen Ländern hat sich bis heute stärker das Label »Familientherapie« erhalten.
2Corina Ahlers, Uli Clement, Reinert Hanswille, Thomas Hegemann, Joachim Hinsch, Ralf Holtzmann, Rudolf Klein, Klaus Müller, Cornelia Oestereich, Hans Schindler, Beate Ch. Ulrich, Gunthard Weber.
Teil 1: Grundlagen systemischer Therapie und Beratung
Auch wenn die systemische Therapie und Beratung eine mittlerweile (seit Anfang der 1980er-Jahre) über 30-jährige Geschichte hat, deren Wurzeln weiter in die 1950er-Jahre zurückreichen, soll diese Geschichte hier nicht linear nacherzählt werden. Das Lehrbuch beginnt vielmehr mit der Einordnung systemischer Therapie und Beratung als transdisziplinäres und multiprofessionelles Projekt ( Kap. 1.1). Damit wird ein Unterschied zu Therapieschulen vorgenommen, die die psychotherapeutische Praxis als rein psychologische oder ärztliche Tätigkeit verstehen und auf die entsprechenden medizinisch-psychologischen Kontexte beschränken, und es wird hier der Konflikt zwischen einer Kultur der Medikalisierung psychischer und sozialer Probleme, die für das institutionalisierte psychotherapeutische Versorgungssystem kennzeichnend ist, und einer aus systemischer Sicht angemesseneren psychosozialen Perspektive nachgezeichnet.
Systemische Therapie und Beratung wird von Angehörigen ganz unterschiedlicher Berufsgruppen in den verschiedensten Praxisfeldern ausgeübt. Kapitel 1.2widmet sich einigen besonders wichtigen Disziplinen und beruflichen Zugängen, nämlich der Psychologie, der Medizin, der Sozialen Arbeit, den Sozialwissenschaften, der Pädagogik, der Theologie und Seelsorge und der Krankenpflege.
Die verbindenden epistemologischen und philosophischen Grundlagen werden in Kapitel 1.3ausführlich behandelt. Es zeigt sich, dass der systemische Ansatz keine einheitliche, inhaltlich konsistente Arbeitsphilosophie darstellt, sondern eine Vielzahl von Konzepten und theoretischen Modellen umfasst, die untereinander mehr oder weniger anschlussfähig sind, aber gemeinsame Grundorientierungen und -haltungen aufweisen. Die Anordnung der einzelnen Beiträge in diesem Kapitel lässt sich also auch als eine Ideengeschichte des systemischen Ansatzes lesen.
Kapitel 1.4beschäftigt sich mit grundlegenden Phänomenen, die die Dynamik in allen sozialen Systemen beeinflussen und mit denen Therapeutinnen und Berater zu tun haben. Das betrifft die Rolle von Affekten und Emotionen, von Geschlechtsunterschieden und Sexualität, den Stellenwert der mehrgenerationalen Loyalitätsdynamik, von Macht, Gewalt und Geheimnissen sowie die Bedeutung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ein ganz grundlegender Aspekt der Produktion und Organisation von Bedeutung, wie er in psychischen und sozialen Systemen im Allgemeinen, im therapeutischen Dialog im Besonderen auftritt, nämlich die Rolle von Metaphern, wird in Kapitel 1.5besprochen.
Auf der Basis dieser praktischen und theoretischen Zugänge wird im Kapitel über Diagnostik (1.6) der besondere Stellenwert nachvollziehbar, den die Kritik an der Übertragung eines medizinischen Diagnostikmodells auf die Bearbeitung psychischer und sozialer Probleme in der systemischen Therapie und Beratung einnimmt, womit sich die Frage nach einer Alternative stellt. Auch hier findet sich allerdings eine große Bandbreite an unterschiedlichen Positionen, die sich nicht in eine spezifische Ausrichtung bringen lassen, sondern die unterschiedlichen Spielarten systemischen Denkens zum Ausdruck bringen. (Tom Levold)
1.1Therapie und Beratung als systemische Praxis
1.1.1Systemische Therapie als transdisziplinäres und multiprofessionelles Konzept
Tom Levold
Читать дальше