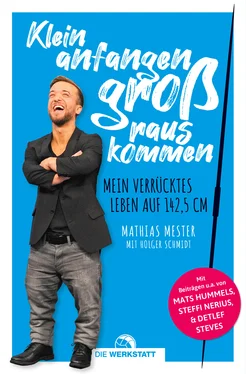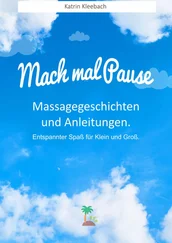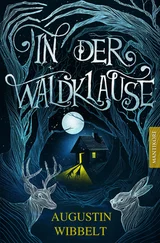Natürlich spreche ich offiziell und ganz selbstverständlich auch vom Behindertensport. Das Kind heißt nun einmal so. Deshalb werde ich Begriffe wie „Behinderung“ oder „Behindertensport“ immer wieder benutzen müssen. Gefallen tun sie mir überhaupt nicht. Aber die Alternativen sind auch nicht besser. Versehrtensport, Handicap-Sport, Sport für Menschen mit Einschränkungen. Mannomann. Kann sich da bitte mal jemand was Nettes einfallen lassen? Immerhin hat sich inzwischen vielerorts die Bezeichnung Para-Sport durchgesetzt. Für viele ist und bleibt es aber Behindertensport.
Ich merke ja selbst, welche Abwertung man mit diesen Begriffen hervorruft. Wenn ich erzähle: „Ich bin Leistungssportler und war kürzlich in Rio“, dann sagen alle: „Wow, cool. Da warst DU dabei? Überragend!“ Obwohl sie natürlich sehen, dass ich klein bin und ihnen klar ist, dass ich nicht bei Olympia gegen 1,95 m große Konkurrenten angetreten bin. Sage ich aber von mir aus: „Ich bin Behindertensportler und war bei den Paralympics dabei“, bekommt der Ton meines Gegenübers direkt etwas Mitleidiges. Und statt Begeisterung ernte ich dann oft ein Schulterklopfen mit den verlegenen Worten: „Schön, dass du dabei warst.“
Das Wort „behindert“ enthält etwas Bemitleidenswertes, Hilfsbedürftiges. Aber so fühle ich mich nicht. Und das bin ich auch nicht. Ich will nicht in Watte gepackt und gesondert behandelt werden. Und das möchten auch meine Kolleginnen und Kollegen nicht, denen ein Bein oder ein Arm amputiert wurde. Sie und wir alle wollen ganz normal akzeptiert und behandelt werden. Das kann doch nicht so schwer sein!
Gerade die Kollegen, die ich im, nun ja, „Behindertensport“ treffe, leben auch vor, dass sie kein Mitleid brauchen. Prothesen-Sprinter Heinrich Popow zum Beispiel, mein guter Freund, dem als Kind wegen einer Krebserkrankung ein Bein abgenommen wurde. Wenn ich sehe, mit welcher Offenheit, welchem Humor und welcher Selbstironie er durchs Leben geht, da können sich viele Nichtbehinderte eine Scheibe abschneiden. Und wenn uns Dinge passieren aufgrund unserer Behinderung, dann ist das kein Drama. Der sehbehinderte Sprinter Thomas Ulbricht ist bei den Paralympics in Rio in den Pool des Deutschen Hauses gefallen. Ganz einfach deshalb, weil er ihn nicht gesehen hat. Auf einmal machte es platsch, und er lag drin. Manche haben sich umgedreht und verschämt gelacht, andere sind direkt hingerannt und wollten dem armen Kerl raushelfen. Thomas ist einfach aus dem Pool geklettert und weiter gings. Es war ja nichts passiert. Er ist nass geworden, fertig. Mitleid brauchte er dafür keins. Und er selbst hat die Geschichte seitdem schon einige Male fröhlich lachend erzählt.
Mein Stolz verbietet es mir meist auch, die möglichen Vorteile auszureizen. Ich habe einen Behindertenausweis – noch so ein Wort –, der mich als 60 Prozent eingeschränkt ausweist. Wenn ich den zücke, gehen Türen auf. Aber ich bin niemand, der mit dem in die Luft gereckten Behindertenausweis durch die Welt läuft und versucht, links und rechts die Vergünstigungen einzusammeln. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass das Leben mir übel mitgespielt hat und ich somit das Recht hätte, mir so viel wie möglich zurückzuholen. Ich könnte natürlich auch den ganzen Tag die Mitleidsschiene fahren. Kaum jemand würde mir die Hilfe verweigern. Aber ich bin froh, dass ich alles oder zumindest das allermeiste kann. Und ich empfände es als unfair denen gegenüber, die wirklich solche Einschränkungen haben, dass sie auf Hilfe angewiesen sind.
Sechzehn neunzig – Immer diese Scheiß-Toleranz
Okay, ich gebe zu, manchmal, in ganz seltenen und besonderen Fällen, versuche ich doch, Kapital aus meiner Behinderung zu schlagen. Und verzweifle dann an der Toleranz meiner Mitmenschen. Ich erinnere mich noch gut an einen Tag im Zoo von Münster. Ich wollte an der Kasse den ermäßigten Behindertentarif zahlen. Und die Frau am Schalter sagte ohne jede Regung: „Ja klar, haben Sie Ihren Ausweis dabei?“ Ich lächelte kurz und sagte: „Der war gut.“ Dann legte ich die abgezählten 12,90 Euro für die ermäßigte Karte hin. „Denken Sie, ich mache Witze?“, fragte die Frau, nun mit einem barschen Unterton. Jetzt wurde ich unsicher. Meinte die das ernst? Hing hier irgendwo eine versteckte Kamera? Ich konnte kaum über die Theke schauen, sie war im Sitzen größer als ich im Stehen und sie fragte mich ernsthaft nach einem Ausweis? „Nein, habe ich nicht“, sagte ich: „Meine Statur ist mein Ausweis.“ Doch auch das zog nicht. „Hören Sie mal, junger Mann“, sagte die Dame, und nun klang sie fast ein wenig herrisch: „Die Regeln sind doch ganz einfach: Kein Ausweis, keine Ermäßigung. Haben Sie einen?“ „Nein“, sagte ich. „Macht sechzehn neunzig“, sagte die Dame. Ich zahlte und dachte: Immer diese Scheiß-Toleranz!
Manchmal, aber wirklich noch viel seltener, mache ich mich auch noch ein bisschen behinderter, als ich bin. Wieso das, werden Sie sich fragen. Das verträgt sich doch nicht mit all dem bisher Gesagten. Ja, das stimmt, doch ich spreche natürlich von Ausnahmesituationen. Situationen, in denen ich die Ohnmacht gegenüber den Kindersprüchen in meinem Rücken beim ersten Date umdrehen will. Wenn ich versuche, eine Frau gleich von meinen besonderen Vorteilen und Vorzügen zu überzeugen. Dann leihe ich mir auch schon mal einen Behindertenausweis von Freunden, die 100 Prozent haben und das Merkzeichen aG, also „außergewöhnliche Gehbehinderung“. Mit dem darf ich nämlich zum Beispiel am Kino bis vor die Tür fahren. Was ich mit meinem Ausweis mit 60 Prozent nicht dürfte. Damit kann man ganz schön auf dicke Hose machen. Damit kann ich der Frau etwas bieten, was nur ich ihr bieten kann. Okay, ich muss dafür ein bisschen schummeln. Aber das klappt letztlich immer, weil die wenigen Parkwächter, die das kontrollieren, meist nicht genau genug informiert sind. Sie sehen einen Behindertenausweis und einen Behinderten, und das passt dann zusammen. Wie viel Prozent dieser oder jener normalerweise haben müsste, entzieht sich ihrer Kenntnis.
Beim zweiten Date muss ich dann aber doch die Hose runterlassen. Denn immer kann ich das nicht bringen. Allein schon wegen der Gewissensbisse. Schließlich klaue ich im Endeffekt einem wirklich Bedürftigen den benötigten Platz am Eingang. Und das kann ich vor meinem Gewissen nur dann verantworten, wenn ich – blind vor Verliebtheit – den Egoismus ausnahmsweise über die Empathie stelle.
Im Endeffekt möchte ich nicht klagen, aber andererseits den Nachteil -oder meinetwegen auch die Behinderung – Kleinwuchs keineswegs bagatellisieren. Und ich möchte die Chance nutzen, hier einmal ausführlich zu erzählen, was in meinem Leben anders ist als in dem Leben gewöhnlich großer Menschen. In dem Wissen, dass man am Ende, unter dem Strich, zu einem anderen Gesamturteil kommen kann als ich, der kleine Dauer-Optimist, der ewige Positiv-Denker.
„Wir“ sind nicht alle gleich
Ich habe mich zwar auch immer ein wenig für das Leben anderer Kleinwüchsiger interessiert. Geschaut, was sie so machen. Aber ich habe nie zwanghaft ihre Nähe gesucht. Es gibt bestimmte Gruppen von Behinderten, die fast nur untereinander kommunizieren. Die feste Communities haben, dauernde Treffen, wo sich die Personen aus Schleswig-Holstein und aus Bayern fast alle kennen, wenn sie die gleiche oder ähnliche Behinderung haben. Bei Kleinwüchsigen, oder zumindest bei mir und den meisten, die ich kenne, ist das nicht so. Ich suche weder den Kontakt zu anderen Kleinwüchsigen, noch meide ich ihn. Ich habe Kontakt mit Menschen, die mir sympathisch sind. Egal, wie groß oder klein, dick oder dünn, alt oder jung sie sind, wo sie herkommen und welche Sprache sie sprechen. Und es gibt unter den Kleinwüchsigen prozentual sicher genauso viele Arschlöcher und nette Menschen wie unter allen anderen auch. Und für mich gilt: Ob kleines Arschloch oder großes Arschloch, ist egal. Und genauso eben, ob ich kleine nette Menschen treffe, normale nette oder große nette.
Читать дальше