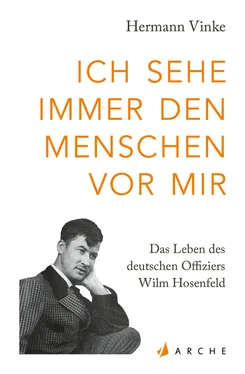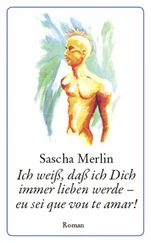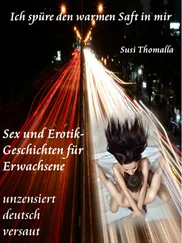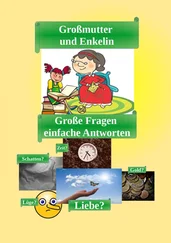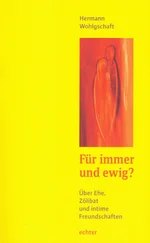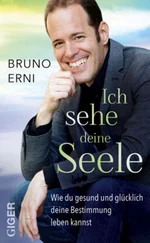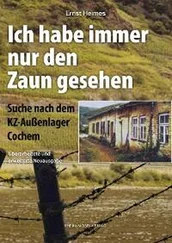Wilm Hosenfeld begegnete dem Terror auf Schritt und Tritt und weigerte sich, davor die Augen zu verschließen. Aus Łódź, der Stadt mit dem größten Getto in den vom Deutschen Reich besetzten Gebieten, erfuhr er im November 1939, dass Juden zum Bahnhof getrieben wurden, beladen mit ihrem Gepäck, erkennbar an einer Armbinde, die selbst Kinder tragen mussten. Sie wurden in Viehwaggons gepfercht und abtransportiert, angeblich zur Umsiedlung nach Russland. Über die rohe Behandlung durch das deutsche Bahnpersonal empörte er sich. Der Jude werde weniger geachtet als ein Stück Vieh, schrieb er. Zufällig hörte Hosenfeld, wie ein Offizier einen Gestapo-Beamten angesichts der Welle von Verhaftungen fragte, ob er der Meinung sei, mit solchen Methoden diese Menschen für den Aufbau gewinnen zu können. Daraufhin habe der Polizist erwidert, ob er etwa glaube, dass auch nur einer von denen zurückkomme. Sie würden alle auf der Flucht erschossen.
Wenige Tage später erreichte Hosenfeld mit seinem Vorauskommando die Kleinstadt Kałyszyn in Masowien 50 Kilometer östlich von Warschau, um Unterkünfte für seine Kompanie zu beschaffen. Allerdings gab es dort kaum noch intakte Häuser. Denn die Wehrmacht hatte wenige Wochen zuvor bei ihrem Feldzug fast die gesamte Stadt in Schutt und Asche gelegt und die jüdischen Einwohner deportiert. Hosenfeld kam mit seinen Soldaten in einem Pfarrhaus unter, wo bereits Flüchtlinge aus dem von der Roten Armee besetzten Ostpolen Platz gefunden hatten. Beim Vikar legte er, wie er seiner Frau mitteilte, eine Beichte ab, obwohl dieser kaum Deutsch verstand. Hosenfeld nahm seine Lateinkenntnisse zu Hilfe.
Nächste Station war die Stadt Węgrów, 240 Kilometer von Pabianice entfernt. Dort übernahm die Wehrmacht polnische Kasernen, die den Polenfeldzug unbeschadet überstanden hatten. Das Stadtgebiet selbst glich eher einer Trümmerlandschaft. Zwischen Brandruinen und zerstörten Häusern spielte eine deutsche Militärkapelle Märsche und Melodien aus Opern und Operetten. Polnische Kinder und alte Männer hörten zu. Wilm Hosenfeld war das Absurde dieser Situation bewusst. Was die Einwohner dringender brauchten als ein Platzkonzert mit Marschmusik waren Lebensmittel und Kohle für den bevorstehenden Winter.

Ruinen entlang der Dorfstraße unweit von Węgrów
Am Bahnhof der Kleinstadt erlebte der Feldwebel die Ankunft eines Zuges mit Flüchtlingen aus den polnischen Gebieten, die dem Deutschen Reich angegliedert wurden und der »Germanisierung« unterlagen; das heißt, aus den neu geschaffenen Reichsgauen Danzig-Westpreußen und Wartheland wurde die einheimische Bevölkerung vertrieben, um Raum für deutsche Siedler zu schaffen. Aus dem zum Platzen gefüllten Zug stürzten die armen Menschen heraus, ihre kläglichen Habseligkeiten mit sich schleppend, wankende Greisinnen und Greise, Männer, Frauen und viele, viele Kinder. In einem Kinderwagen saß ein kleines Mädchen, fast erdrückt von den Packen und Decken und Sachen, aber es war ein so süßes, wonniges Kindchen mit so leuchtenden, frohen Kinderaugen, dass ich gar nicht wegsehen mochte. In diesem Moment fühlte er sich hilflos, kramte Bonbons aus seiner Tasche und gab sie dem Kind.
Solche Eindrücke schilderte Hosenfeld zumeist in den Briefen an seine Frau. Seinem Tagebuch vertraute er darüber hinaus die ohnmächtige Wut an, die er beim Anblick der Flüchtlinge empfand. Eine Frau suchte verzweifelt nach warmem Wasser für ihr Kleinkind. Ein alter Mann fragte ihn, wohin sie gehen sollten. Ein Bauer berichtete, er sei gerade mit Pferd und Wagen aus dem Wald gekommen; da hätten die Deutschen ihm zehn Minuten gegeben, seine Frau, die Kinder und die Großeltern zu sammeln und das Nötigste an Gepäck mitzunehmen. Sie seien völlig mittellos, hätten nichts zu essen und wüssten nicht wohin.
Und ich kann ihnen nicht helfen, notierte er verbittert. Das Unglück schneidet mir ins Herz. So sieht die Umsiedlung aus, von der man so große Töne redet. Im Bahnhofsgebäude drängen sich die Menschen, sie suchen Schutz vor der Kälte. Ein großer, hagerer Mann mit einer schwarzen Pelzmütze auf dem feinen Kopf schaut mich mit ernsten Augen an. Er muss in mir auch so einen Unmenschen sehen, oder meint er, dass ich ein gutes Herz habe? Ich hätte gerne mit ihm geredet, aber ich scheue mich, ihn anzusprechen. Er ist einer von den Intellektuellen, die man ausrotten will.
Warum reißt man diese Menschen aus ihren Behausungen, wenn man nicht weiß, wo man sie unterbringen soll, fragte Hosenfeld sich. Einen Tag lang stehen sie in der Kälte, sitzen auf den Bündeln, ihren kärglichen Habseligkeiten, man gibt ihnen nichts zu essen. Da liegt System darin, man will diese Menschen krank, elend, hilflos machen, sie sollen umkommen. Was der Krieg verschont hat, will man so umbringen, auf diese ruchlose Weise. Woher ist dieser teuflische Plan, wer kann so mit Menschen umgehen? Zunächst machte er das NS-Regime für das Unglück verantwortlich. Aber dann besann er sich und schrieb: Und doch sind wir alle schuld, nein, wir sind alle belogen und hintergangen worden. Eine tiefe Traurigkeit legt sich mir in die Seele.
Zwischen dem 13. und 16. Dezember 1939 schrieb er mehrere Briefe und längere Aufzeichnungen. Er hielt es kaum aus, das Los der Flüchtlinge mitansehen zu müssen und nichts für sie tun zu können. In seinem Gepäck hatte er Brot und Käse mitgebracht, aber es reichte natürlich nicht für die vielen Menschen. Hosenfeld suchte immer wieder das Gespräch und erfuhr weitere Einzelheiten. Drei Frauen hätten während der Zugfahrt entbunden. Eine habe versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. In einem Waggon lag ein Toter. Während er mit den Leuten redete, traf bereits der nächste Zug mit neuen Flüchtlingen auf der Bahnstation in Węgrów ein. Wie viele Schicksale, wie viel Unglück bringt jeder Zug dieser Ausgestoßenen? Ich treffe viele Soldaten, Eisenbahner, Offiziere, sie sind voller Mitgefühl und Empörung, einer sagt: »Man schämt sich, ein Deutscher zu sein.«
Was Wilm Hosenfeld seiner Frau über die Vertreibung der Polen und die Drangsalierung der Juden berichtete, schockierte sie. Annemarie Hosenfeld äußerte die Befürchtung, das Gleiche werde in Deutschland passieren. Die Bevölkerung werde irregeführt. Ich meine, es sei nicht Gottes Wille, dass wir in dieses Unglück immer sicherer hineinrasen, wir müssen uns auflehnen. Wie so oft, wenn sie verzweifelt war, ging sie in die Kirche, um ihre Gedanken zu ordnen und Trost zu finden. Als beim Gottesdienst der Organist das »Largo« von Händel spielte, verlor sie die Fassung und weinte bitterlich. Aus ihren Briefen geht immer wieder hervor, wie verzweifelt sie über den Fortgang des Krieges war: Was sind das für Narren gewesen, die diesen Krieg für eine Lösung der Völkerzwistigkeiten ansahen. Sie glaubte der Propaganda kein Wort. Ende November zog sie gegenüber ihrem Mann ein bitteres Fazit ihrer Hoffnungen und Ängste: Dass Du einmal auf Urlaub kommst, kann ich mir wohl vorstellen, aber dass Du wie immer bei uns sein könntest, dass Du nicht mehr Soldat bist, daran glaube ich nicht mehr. Wenn Du heute nach Hause kommst, sollst Du nichts wissen von meiner Zerrissenheit, ich kann nicht mehr weinen, ich kann nicht mehr beten, ich kann nicht mehr hoffen …
Anfang Dezember 1939 riss eine sehnlich erwartete Nachricht sie aus ihrer düsteren Stimmung: Wilm Hosenfeld kündigte seinen Weihnachtsurlaub an. Er werde die Feiertage in Thalau verbringen, teilte er mit. Das Wiedersehen mit seiner Frau und den Kindern verhieß Glück auf Zeit, keineswegs das Ende aller Sorgen, aber immerhin die Gelegenheit zum Gespräch, statt Briefe zu schreiben.
Читать дальше