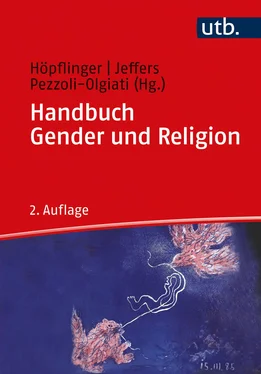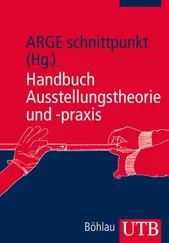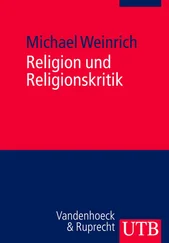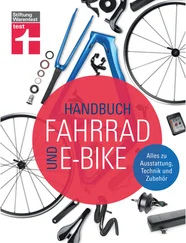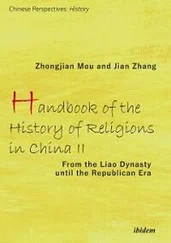Handbuch Gender und Religion
Здесь есть возможность читать онлайн «Handbuch Gender und Religion» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Handbuch Gender und Religion
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Handbuch Gender und Religion: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Handbuch Gender und Religion»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Handbuch Gender und Religion — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Handbuch Gender und Religion», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Stolz, Fritz (2001) [1988], Grundzüge der Religionswissenschaft, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
Udry, Richard (1994), The Nature of Gender, in: Demography 31/4, 561–573.
Voß, Johann Heinrich (2002), Homer, Ilias, Odyssee, München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
West, Candace/Zimmerman, Don H. (1987), Doing Gender, in: Gender and Society 1/2, 125–151.
1 Beard (2017), 3–5. Das Zitat übernimmt die Übertragung von Voß (2002), 450.
2 King (2005), 1–2.
3 Hier nur einige ausgewählte Studien seit der Veröffentlichung der Erstauflage des Handbuchs: Lanwerd/Moser (2010); Dahinden/Höpflinger/Lavanchy (2012); Elsas/Franke/Standhartinger (2014); Stollberg-Rilinger (2014); Knauß/Pezzoli-Olgiati (2015); Benthaus-Apel/Grenz/Eufinger/Schöll/Brücker (2017); Sammet/Benthaus-Apel/Gärtner (2017); Breitenbach/Rieske/Toppe (2019); Behrensen/Heimbach-Steins/Hennig (2019); Kulaçatan/Behr (2020).
4 Neuere deutschsprachige Studien zu Migration, Religion, Gender bieten beispielsweise: Dennerlein/Frietsch (2011); Kulaçatan/Behr (2020); Breitenbach/Rieske/Toppe (2019); zu Gender, Nation und Religion: Behrensen/Heimbach-Steins/Hennig (2019).
5 Zu den verschiedenen Konzepten von Körper und Leib siehe: Schaufler (2002), v.a. 15–77; für Körper, Leib und Geschlecht: Schaufler (2002), 79–112.
6 Beispiele dazu findet man u. a. in Rösing (2013).
7 Diese Perspektive ist geprägt von den Studien von Foucault, bahnbrechend waren diesbezüglich u. a. seine Untersuchungen des Wahnsinns von 1961 und seine Gefängnisstudie von 1975, siehe Foucault (2013) und (2017).
8 Mieke Bal (2002) versteht unter travelling concepts Konzepte, die zwischen Disziplinen, aber auch zwischen Diskursen, Zeiten und Kulturen wandern. Konzepte werden also in ihrer Prozessualität und Transformation untersucht.
9 Zunächst als gender role und gender identity. Siehe zu dieser Entwicklung Udry (1994), 561.
10 Siehe dazu Davis-Sulikowski/Diemberger/Gingrich/Helbling (2001).
11 Zum Beispiel MacCormack/Strathern (1980).
12 Dazu Crenshaw (1994) oder Auga/Guđmarsdóttir/Knauß/Martínez Cano (2014).
13 Siquans/Mulder/Carbonell Ortiz (2020).
14 Udry (1994), 561; West/Zimmerman (1987), 125–127.
15 Butler (1990).
16 West/Zimmerman (1987).
17 Siehe dazu z. B. Geertz (2003), 48; Stolz (2001), 33; Kippenberg/von Stuckrad (2003); Gladigow (2005).
18 Diese Kategorien haben wir bezüglich sichtbarer Religion untersucht. Siehe Fritz/Höpflinger/Knauß/Mäder/Pezzoli-Olgiati (2018).
19 Berger/Luckmann (1984).
20 Siehe Ferrari Schiefer (1998) und ihren Beitrag im vorliegenden Handbuch.
21 Siehe dazu Knauß (2015).
22 Siehe dazu mit Fokus auf sichtbare Religion: Fritz/Höpflinger/Knauß/Mäder/Pezzoli-Olgiati (2018).
23 Das Zusammenspiel der Ebenen Produktion, Rezeption, Repräsentation, Identität und Regulierung wurde ausgearbeitet von Stuart Hall und seinen Mitarbeitenden und visualisiert im sogenannten circuit of culture , einem Modell zur Erfassung kultureller Bedeutungsgenerierung, siehe DuGay/Hall/Janes/Mackay/Negus (1997).
24 Siehe den Beitrag von Ann Jeffers zu dieser »Klassikerin der Religionswissenschaft« im vorliegenden Handbuch.
25 Siehe den Beitrag von Janet Wootton zu globalem Feminismus im vorliegenden Handbuch.
26 Siehe Fritz/Höpflinger/Knauß/Mäder/Pezzoli-Olgiati (2018).
27 Der Begriff »Repräsentationsregime« ( regime of representation ) ist hier im Sinne von Stuart Hall (1997), 232 verwendet. Zu der Macht der Medien siehe die Beiträge in Teil V des vorliegenden Handbuchs.
28 Siehe den Beitrag von Kristina Göthling-Zimpel zu Antigenderismus im vorliegenden Handbuch.
Pierre Bühler
Einleitung
Sobald von Vermittlung die Rede ist, muss berücksichtigt werden, dass eine solche Vermittlung immer nur in einem ganz bestimmten Kontext Sinn macht. Auf diese Kontextbedingtheit hat ganz besonders und mit Nachdruck die Hermeneutik als Theorie der Auslegung und des Verstehens aufmerksam gemacht. In diesem Sinne könnte man sagen, dass die Definition der Religionswissenschaft als »Vermittlung von Weltbildern« in ihr das hermeneutische Moment hervorhebt, und um diesen hermeneutischen Aspekt soll es hier gehen. Alle vier Aufsätze, die diesen ersten Teil des Handbuchs ausmachen, enthalten denn auch, wie mir scheint, klare Ansätze zu einer hermeneutischen Reflexion der Religionswissenschaft.
Sowohl die philosophische als auch die theologische Hermeneutik haben sich intensiv mit dem Thema der Weltbilder, oder vielleicht üblicher in der Terminologie der hermeneutischen Tradition: mit dem Thema der Weltanschauungen, auseinandergesetzt. Dies kann ganz einfach bei Rudolf Bultmann belegt werden: Für seine Hermeneutik spielt das Thema der Weltanschauung eine entscheidende Rolle, auch in seinem Versuch, das Urchristentum religionsgeschichtlich in die antike Welt einzuordnen (eine neuere Beschäftigung dazu findet sich in Christian Berners Buch Qu’est-ce qu’une conception du monde? ). Dabei setzt sich die Hermeneutik kritisch mit der Geschichtsvergessenheit der traditionellen Metaphysik auseinander, die ihre Weltanschauung als geschichtslose, objektive Wahrheit vertrat, ohne zu berücksichtigen, dass diese immer schon historisch und gesellschaftlich vermittelt ist. Die Hermeneutik hingegen betont die Geschichtlichkeit der Weltbilder oder Weltanschauungen und deshalb auch ihre Relativität, ihre Veränderlichkeit und dadurch ihre Interpretierbarkeit. Bultmanns heftig diskutiertes Programm der Entmythologisierung versucht über die Geschichtlichkeit der Weltbilder in Hinsicht auf unseren Umgang mit den biblischen Texten Rechenschaft abzulegen.
Wie steht es nun aber in Hinsicht auf »die Religionswissenschaft als Vermittlung von Weltbildern«? Könnte es sein, dass auch hier manchmal die Vermittlung als »blinder Fleck« behandelt wird, Weltbilder also auch objektiviert, als unmittelbare Wahrheit betrachtet werden? Zunächst muss hier zwischen der Religion selbst und der Religionswissenschaft unterschieden werden. Es ist klar, dass Religionen auf vielfältige Weise Weltbilder entwickeln und deren Vermittlung auch sehr unterschiedlich auffassen. Aufgabe der Religionswissenschaft wäre es dann, auf solche »Weltbilder der Religionen«, wie es beispielsweise der Religionswissenschaftler Fritz Stolz in seinem gleichnamigen Buch von 2001 formuliert, aufmerksam zu machen und sie also in diesem Sinne zu vermitteln. »Vermittlung« könnte hier also im Sinne von »Bekanntmachen, Auslegen« verstanden werden. Auf einer Metaebene gibt es aber noch ein anderes Vermitteln von Weltbildern in der Religionswissenschaft, das dieses Handbuch kritisch reflektieren will: das Vermitteln von Weltbildern, die sich mit den methodischen Voraussetzungen der Disziplin verbinden. Diese methodischen, epistemologischen Weltbilder können sich dann auch auf die Wahrnehmung der religiösen Weltbilder auswirken. Kritische Stimmen sagen sogar: Je weniger bewusst sie reflektiert werden, je stärker können sie sich auswirken!
Achtet man auf die Vermittlung dieser Weltbilder oder -anschauungen, wie es die Hermeneutik wünscht, stellt sich unmittelbar das Gefühl einer starken Ambivalenz ein. Weltbilder können sehr unterschiedlich wirken, erklärend oder verdunkelnd, befreiend oder erdrückend, öffnend oder verschließend. Paul Ricœur hat in seinem Werk L’idéologie et l’utopie von 1997 versucht, diese Ambivalenz mit dem Gegensatz von Ideologie und Utopie zu reflektieren: Ideologisch – hier im positiven Sinne zu verstehen – ist ein Weltbild, wenn es den gegebenen Zustand bestätigend aufnimmt und rechtfertigt, warum er so sein soll, wie er ist; utopisch hingegen ist ein Weltbild, das den gegebenen Zustand hinterfragt und subversiv eine Gegenwelt entwickelt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Handbuch Gender und Religion»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Handbuch Gender und Religion» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Handbuch Gender und Religion» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.