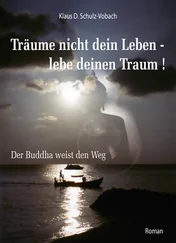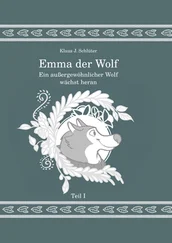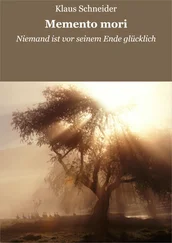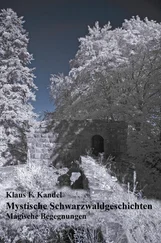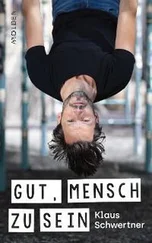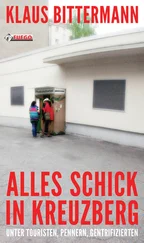„Ich hab immer schon jesagt, datt et besser is, wenn sich die Kulturen und Religionen nitt in et Jeheje kommen. Dä Onkel Max hatte schon recht, wenn er sagt, datt die Juden in der Wüste en eijenen Staat gründen sollten. Ich versteh janich, warum die Nazis denen nit einfach helfen. Dann sinnse die Plach doch los!“ Er meinte Max Bodenheimer, der schon vor dem Krieg einen eigenen Staat auf dem Boden Palästinas eingefordert hatte. Seine National-Jüdische Vereinigung wurde von den Nazis natürlich verboten. Die verfolgten da ganz andere Ziele.
Anat hatte wirklich keine Lust, sich mit seinem Schwieger-Opa in Grundsatz-Diskussionen einzulassen. Der über 70-Jährige hatte seine Meinung über Jahrzehnte geformt und in vielen weinseligen Stunden gefestigt; jeder Widerstand war da zwecklos. Er musste vielmehr versuchen, an die Güte des alten Mannes und an seine Vorstellung von der Trennung der Religionen zu appellieren.
Die Sekretärin betrat das Büro und stellte ein Tablett mit Kaffeetassen und einer Kanne auf den Tisch. Auf einem Teller lagen zwei dunkle Röggelchen, einige dicke Scheiben alter Holländer Käse und ein Stück geräucherter Bauchspeck, daneben ein Topf Senf, Zwiebeln und ein Stück Butter. Während sie sich weiter unterhielten, beschäftigte sich der Ühm abwechselnd mit dem fetten Frühstück und seiner Zigarre, an der er zwischen den Bissen genussvoll paffte. Anat lehnte dankend ab, als ihn der Ühm aufforderte zuzugreifen.
„Siehst du, Ühm“, setzte Anat das Gespräch fort, als die Frau das Zimmer verlassen hatte. „Das ist genau das, was wir wollen. Wir möchten weg aus Köln, aber wir wollen nicht warten, bis sie uns ausweisen. Dann müsste ich alles zurücklassen, was sich die Familie in über hundert Jahren aufgebaut hat. Und ich habe die Verantwortung für meine Familie. Meine Frau ist immerhin deine Enkelin. Und ob du das nun willst oder nicht, aber du bist der Urgroßvater meiner Kinder.“ Anat wusste, dass er den Nerv des Alten getroffen hatte.
„Warum jehst du nit nach New York?“ – „Damit ich als Lakai bei meinem Onkel anschaffen gehe?“ Er hatte noch in guter Erinnerung, wie ihn sein Onkel Joseph behandelt hatte, als er vor rund zehn Jahren bei der Beerdigung seines Bruders in Köln war.
„Wie ich in dingem Alter jewesen bin, wär´ ich froh jewesen, wenn mir einer so´en Anjebot jemacht hätte. Wer weiß, wie lang datt noch juht jeht, wie lang se euch noch in Ruh´ lassen. Un Amerika is jroß. Du muss ja nit bei dingem Onkel arbeiten.“
„Wir würden am liebsten in die Schweiz gehen.“ – „Damit et dir jenauso jeht, wie dem Tietz. Dem habense alles abjenommen. Da kann ich dir nit helfen. Aber ich kann dafür sorjen, datt ihr nach Holland kommt. Da habbich en paar Freunde, die mir noch watt schuldig sind und die euch helfen, auf en anständijes Schiff zu kommen. Drüben wird euch dann erst mal der Hannes helfen.“
Insgeheim musste er dem Ühm recht geben. Die Tietz´ waren vor einigen Jahren in die Schweiz geflüchtet, nachdem der Horten-Konzern ihnen mit Hilfe der Hamburger Commerzbank ihren gesamten Besitz, der immerhin aus dem größten deutschen Kaufhaus-Konzern mit zwei Dutzend Filialen bestand, für einen lächerlichen Betrag abgekauft hatte. Da war er eigentlich besser dran, weil sein Besitz wesentlich kleiner war und nicht aus unbeweglichen Immobilien bestand. Sollte er den Ühm einweihen? Letztlich wird er es müssen, wenn er sein kleines Vermögen mit in die Staaten nehmen wollte. Aber darüber musste er erst mal mit Rinah sprechen.
„Meinst du, dass das klappt?“ „Ihr seid nich die Ersten, die mir rausschaffen. Mir sin doch froh, datt mir die los sind.“
Sein Hausdiener Emil, der dem Ühm treu ergeben war, würde sich um die Einzelheiten kümmern und dafür sorgen, dass sie mit dem Nötigsten versorgt die Ausreise antreten könnten. Der Ühm nannte ihm noch ein paar Fakten und sie kamen überein, dass ihm Anat in der kommenden Woche Bescheid geben wolle. Für das Wochenende hatten sich Willi und Heidrun angemeldet und ohne den Rat seines Freundes wollte Anat keine Entscheidung treffen.
Es war Mittwoch, der 9. November 1938. Stunden später sollte nichts mehr so sein, wie es mal war.
Als Anat durch die Straßen Kölns nach Hause ging, fiel ihm schon auf, dass offensichtlich mehr Braunhemden unterwegs waren als gewöhnlich. Wahrscheinlich rotten sie sich wieder zu einer ihrer Kundgebungen zusammen, dachte er und machte, dass er in seine Wohnung kam.
Die Nacht war fürchterlich. Der Mopp draußen verschonte kein einziges jüdisches Geschäft, Hunderte wurden restlos zerstört. Die Synagogen in der Roonstraße und der Glockengasse brannten nieder und die Juden, die sich auf den Straßen sehen ließen oder von den Banden aus den Häusern getrieben wurden, wurden gedemütigt, verprügelt und viele abtransportiert. Die Nacht würde sich als „Reichskristallnacht“ in der Historie der Nazi-Diktatur wiederfinden.
Anat, seine Frau Rinah und die beiden Kinder verkrochen sich auf dem Dachboden und hofften, dass niemand auf die Idee käme, hier nachzuschauen, und die anderen Hausbewohner sie nicht verrieten. Denunzianten waren der Klebstoff, der dieses Regime zusammenhielt, und niemand war wirklich sicher, nicht von seinem Nachbarn oder Kollegen im Verein oder in der Fabrik angeschwärzt zu werden.
„Wir müssen hier fort – bald!“ Rinah nickte nur, zog die Kinder an sich heran und versuchte, nichts von dem hören zu müssen, was draußen vor sich ging. „Ich habe mit dem Ühm gesprochen. Er muss uns helfen, hier wegzukommen.“ Rinah nickte wieder. Ihr war alles egal. Nur weg von hier, weg aus Deutschland, weg von diesen Nazi-Schergen.
Anat dachte angestrengt nach. Sollte er den Ühm einweihen? Sollte er ihm verraten, was er unter dem Kellerboden seiner Werkstatt in der Rheinstraße verborgen hatte?
Wahlscheid, Juni 1955
Joachim
Der enge Feldweg am Bach vorbei bis zur Katharinenbach war mit Fahrzeugen aller Art zugestellt: Einige Autos, Traktoren, Motorräder, merkwürdig aussehende, dreirädrige Selbstbau-Gefährte mit Ladeflächen aus rohen Holzplanken, ein kleiner LKW und sogar ein Pferdegespann standen halb auf dem ausgefahrenen Weg und halb auf der Uferböschung des kleinen Wildbachs, der sich den Hügel herunterschlängelte.
Es würde wieder allerhand Volk unterwegs sein. Der „Schüereball“ auf dem kleinen Weiler oberhalb von Wahlscheid war in jedem Jahr Anlaufstelle für alle Schichten der Bevölkerung. Hier saßen „Drogi“, der Inhaber der kleinen Drogerie und der örtliche Autohändler neben dem polnischen Knecht, der auf irgendeinem Bauernhof in der Nähe schuftete, die Vorsitzenden von Sportverein und Männerchor versuchten mit dem Bürgermeister sich gegenseitig unter den Tisch zu saufen und die Dorfjugend nutzte den Abend für das eine oder andere Techtelmechtel und um die Angebetete zu mehr als einem flüchtigen Kuss ins Heu zu zerren. Auf diesem Fest, neben der Kirmes im August wichtigster Treff für kollektives Wirkungstrinken, wurde sich ebenso oft endgültig zerzankt wie wieder vertragen.
Ursprünglich gab es diese Feiern, um eine neu errichtete Scheune („Schüer“ oder „Schür“) einzuweihen, die tags zuvor in einer gemeinsamen Aktion der Bauern von den umliegenden Höfen errichtet worden war. Man half sich gegenseitig und der Lohn bestand dann darin, dass der Besitzer der neuen Scheune eine Sau schlachtete und ein Fass aufmachte. Dieser alte Brauch war längst vergessen, aber „der Baacher“, wie der Pächter der Katharinenbach genannt wurde, und seine Frau Elisabeth hatten die alte Sitte aufgegriffen und feierten einmal im Jahr das Scheunenfest, und das Volk nahm dankbar an, dass es zu kleinen Preisen reichlich kaltes Bier, jede Menge meist selbstgebrannten Schnaps und Berge deftiger Hausmannskost gab.
Читать дальше