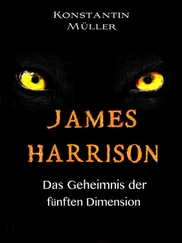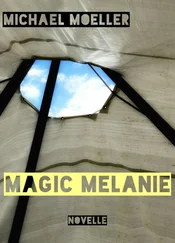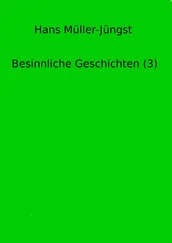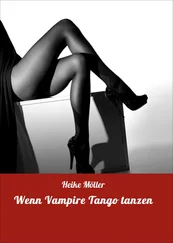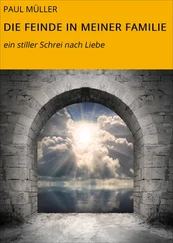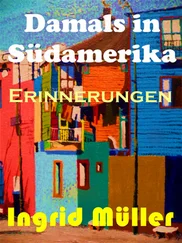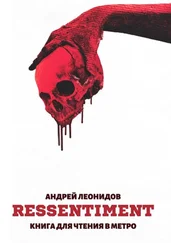Sie gibt allerdings zugleich Raum für die Möglichkeit, dass sie sich nicht bloß relativ willkürlich gegen Ersatzobjekte zu richten beginnen, sondern auch gegen ihr Subjekt selbst. Dann kommt es zur Internalisierung der ressentimentalen Affekte: da ihnen die Entladung nach außen versagt bleibt, bleiben sie nicht nur in ihrem Träger, stauen sich in ihm auf, und prägen sein Fühlen und Empfinden – sie richten sich schließlich auch noch gegen ihn selbst. So verschärfen sie sogar die prekäre Situation des Ressentimentalen, erhöhen noch einmal den Druck auf sein problematisches Selbstbild und sein Selbstverhältnis: »es tritt der Zustand des ›Selbsthasses‹, der ›Selbstqual‹, des ›Rachedurstes gegen sich selbst‹ auf«. 30Insofern kann man die Internalisierung der Ressentimentaffekte als katalytisches Moment deuten, das die selbstbildstabilisierenden Maßnahmen nur umso dringlicher macht – das den Ressentimentalen schließlich über den Rand des Abgrunds treibt.
SELBSTBILDSTABILISIERENDE MASSNAHMEN
Den selbstbildstabilisierenden Maßnahmen, die auf der Diffusion der Ressentimentaffekte aufbauen und sich aus ihr heraus entfalten, eignet als zentrales Element die Instrumentalisierung ›des Anderen‹ – genauer: der Antagonismus zum Anderen. Es kommt zu einer mehrschichtigen Feindbildkonstruktion . »Der Mensch des Ressentiment […] bedarf des gehaßten Feindes«, er bedarf »jener Umwelt von Bösen«. 31Die Hervorbringung dieser Feindschaft, wird nun zur zentralen Funktion des Ressentiments für seinen Träger. Hierauf läuft seine innere Logik hinaus: auf die Entlastung des eigenen Selbstbildes auf Kosten des Anderen – der durch den vom ressentimental vorgeprägten Erlebnishorizont her verzerrten Wahrnehmungsapparat zum Feind umgesehen und umgedeutet wird.
Dann kommt es etwa zur Schuldfrage – und zur Schuldverlagerung. Aus der Schmach der eigenen Unterlegenheit, dem Minderwertigkeitsgefühl und der immer wieder als überwältigend empfundenen Ohnmacht entwächst eine Suchbewegung nach den ›wahren‹ Schuldigen für die eigene Misere. Der Ressentimentmensch benötigt sie, um sich seine prekäre Lage, sein Versagen zu erklären und sich gleichsam vor sich selbst zu rechtfertigen. So projiziert er die Schuld auf andere: nicht die eigenen Unzulänglichkeiten haben ihn in diese Lage gebracht – es waren die Anderen, die ihn niederhalten und unterdrücken; es waren die Anderen, die ihn verraten haben, ihn in seinem Wohlwollen hintergangen haben; immer die Anderen, die sich gegen ihn verschworen haben. Die Externalisierung der Schuld an der eigenen Lage ändert noch nichts an seiner Lage – doch der Ressentimentmensch erfährt zumindest dadurch, dass er nicht auch noch die Schuld an ihr trägt, eine Entlastung seines Selbstbildes. Er kann sich davon frei sprechen. Doch darüber hinaus erwächst ihm auf diese Art ein Schuldiger, dem er wenigstens wieder grollen kann, den er – anders als sich selbst – hassen und verachten, anklagen und verurteilen, gegen den er auf Rache sinnen kann. »[J]eder Leidende nämlich sucht instinktiv zu seinem Leid eine Ursache; genauer noch, einen Thäter, noch bestimmter, einen für Leid empfänglichen schuldigen Thäter, – kurz, irgend etwas Lebendiges, an dem er seine Affekte thätlich oder in effigie auf irgend einen Vorwand hin entladen kann«. 32Die damit in Gang kommende Abfuhr all seiner Ressentimentaffekte allein verschafft ihm in seiner Situation bereits Erleichterung.
In engem Zusammenhang mit der Schuldverlagerung steht ein psychologischer Mechanismus, den Scheler als »Kausaltäuschung« beschreibt. Danach neigt der Ressentimentale dazu, eine kausale Verknüpfung des eigenen Ergehens mit den Taten anderer herzustellen – stellt dabei aber häufig Zusammenhänge her, wo gar keine sind. Es kann ihm nicht einfach so schlecht ergehen, etwa durch Zufall, Schicksal, am wenigsten durch eigenes Unvermögen: jemand anderes muss dahinter stecken, muss es aktiv und absichtlich herbeigeführt haben. Dem eigenen Missgeschick wird das intentionale Handeln eines Anderen untergeschoben. 33
Der Ressentimentmensch neigt aber nicht bloß zur Projektion der eigenen Schuld und der eigenen Verantwortlichkeit an seiner misslichen Lage auf andere. Er neigt auch zu der Projektion derjenigen eigenen als minderwertig empfundenen Eigenschaften und Wesenszüge, unter denen sein Selbstverhältnis so sehr leidet. So gelingt es ihm, die inneren Selbstzweifel, die maßlose Enttäuschung über sich selbst, die daraus resultierende Scham, den Selbsthass abzuspalten und zu manifestieren. Es gelingt ihm, die innere Stimme, die ihm unablässig zuflüstert: ›Du bist Dreck!‹, zum Schweigen zu bringen – und indem er sie auf ein äußeres Objekt überträgt, eröffnet sich ihm die Möglichkeit, diese Stimme und alles Widerwärtige, das sie repräsentiert, rückhaltlos zu bekämpfen. Der Andere wird so willkürlich zum Vehikel der eigenen verhassten Anteile und damit zur Zielscheibe der ressentimentalen Aggressionen. Doch diese Entlastung ist nie vollständig und nie von Dauer. Denn die innere Stimme, das eigene unbarmherzige Urteil über sich selbst, wird ja in dem beschriebenen Akt nicht wirklich ausgelöscht. Sie regt sich bald wieder und gewinnt wieder an Lautstärke. Die Konsequenz ist ein Kreislauf aus eskalierendem Selbsthass, dem Entlastungsversuch durch projektive Manifestation und sich erneut aufbauendem Selbsthass. 34
Wohl am ehesten der im allgemeinen Sprachgebrauch geläufigen Bedeutung von Ressentiment entspricht die Selbststeigerung durch Herabsetzung des Anderen . Scheler beschreibt diesen Mechanismus als »Werttäuschung«, als die »illusionäre Herunterdrückung der wertvollen Eigenschaften des Vergleichsobjekts« beziehungsweise als eine »spezifische ›Blindheit‹ für sie«. 35Der Druck, der auf dem Selbst angesichts seiner ewigen Unterlegenheit lastet, vermindert sich, sobald der Andere seiner Überlegenheit beraubt ist. Je mehr das Vergleichsobjekt in seinem Wert herabgesetzt wird, desto mehr löst sich die Spannung zwischen der angestrebten Selbstbehauptung und der eigenen Unfähigkeit dazu. Auf diese Weise gelingt es, das eigene »Lebens- und Machtgefühl« wieder zu steigern – »wenn auch auf illusionärer Grundlage«. 36Dabei bilden die ressentimentalen Entwertungsmechanismen vielfältige Strategien aus. Bei der direkten Herabwürdigung wird schlichtweg der Wert des Anderen geleugnet, der Wert seiner Person, seiner Eigenschaften und Fähigkeiten, seiner Leistungen und Errungenschaften. Scheler verweist auf die Metapher vom Fuchs und den zu sauren Trauben. Der Fuchs, der sehnsüchtig nach den schon überreifen Trauben blickt, sie aber trotz mehrerer Versuche nicht erreichen kann, weil sie zu hoch hängen, wendet sich schließlich von ihnen ab mit dem Hinweis, dass sie ihm ja noch zu unreif und darum zu sauer wären. 37Bei der indirekten Herabwürdigung werden dem Anderen nicht rundheraus sein Wert, seine Vorzüge und Erfolge abgesprochen – stattdessen »wird etwas, ein A, bejaht, geschätzt, gelobt, nicht um seiner inneren Qualität willen, sondern in der – aber ohne sprachlichen Ausdruck bleibenden – Intention, ein anderes, B, zu verneinen, zu entwerten, zu tadeln. Das A wird gegen das B ›ausgespielt‹«. 38Um im Bild zu bleiben: der Fuchs würde etwa unter dem Hinweis, dass die tiefer hängenden Brombeeren doch viel besser schmecken und eigentlich niemand Trauben wirklich mag, betont lässig davon trotten. Alternativ beschreibt Scheler die Herabwürdigung des Anderen nicht durch die Leugnung seines Werts, sondern durch Modifikation des Wertungssystems selbst. Nicht der Wert der Person des Anderen und seiner Qualitäten wird dann geleugnet, sondern der Wertmaßstab, nach dem dieser bisher bemessen wurde, wird auf den Kopf gestellt, das bisher Gute als doch eigentlich schlecht umgedeutet. Während der Fuchs eben noch die Reife der Trauben leugnete, was ja nach wie vor den Wohlgeschmack süßer Trauben zur Grundlage hat, gesteht er jetzt zu, wie reif und süß die Trauben sind – besteht aber zugleich darauf, dass süße Trauben nicht schmackhaft und nur dann wirklich gut seien, solange sie sauer sind! Die Modifikation des Wertungssystems, an dem sich der Eigen- und Fremdwert ermisst, bezeichnet Scheler in Anlehnung an Nietzsche sogar als »Hauptleistung des Ressentiment«. An diesem Punkt setze die »Fälschung der Werttafeln« ein und das Ressentiment beginne, selbst schöpferisch zu werden und neue Werte und Ideale durch die Umwertung des bestehenden Wertekanons hervorzubringen. 39Hier deutet sich denn auch die epochale Wirkungsgeschichte an, die Nietzsche dem Ressentiment in der Genealogie der Moral herbei schreibt, wie weiter unten noch zu betrachten sein wird.
Читать дальше