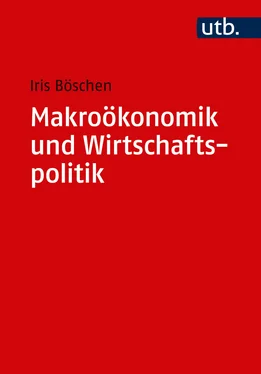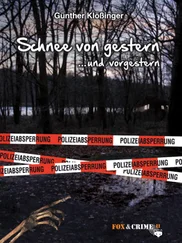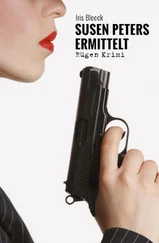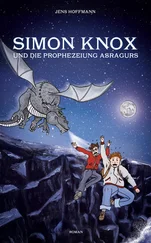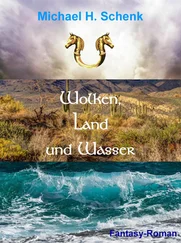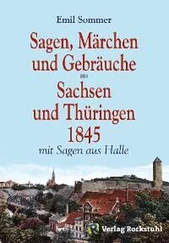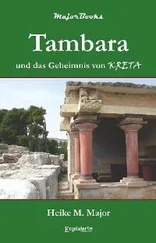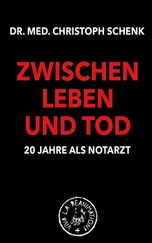Iris Böschen - Makroökonomik und Wirtschaftspolitik
Здесь есть возможность читать онлайн «Iris Böschen - Makroökonomik und Wirtschaftspolitik» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Makroökonomik und Wirtschaftspolitik
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Makroökonomik und Wirtschaftspolitik: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Wie hat sich die deutsche Volkswirtschaft seit der Weltwirtschaftskrise 2009 entwickelt? Iris Böschen erläutert in diesem Lehrbuch die makroökonomischen Entwicklungen der letzten Jahre und vermittelt vor dem Hintergrund aktueller wirtschaftspolitischer Entscheidungen makroökonomische und wirtschaftspolitische Zusammenhänge.
Makroökonomik und Wirtschaftspolitik — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Neben der monetären Überinvestitionstheorie werden weitere monetäre Konjunkturtheorien ins Feld geführt, die allerdings darauf basieren, dass fehlerhafte geldpolitische Maßnahmen der Zentralbank für konjunkturelle Schwankungen verantwortlich sein sollen. Betreibt die Zentralbank eine expansive Geldpolitik indem sie beispielsweise die Leitzinsen senkt oder die Geldmenge ausweitet, so kommt es normalerweise, d.h. wenn der Transmissionsmechanismus funktioniert und die Geschäftsbanken günstige Refinanzierungskosten an die privaten Haushalte und Unternehmen weitergeben, zu einer Kreditexpansion. Diese führt in einer ansonsten normalen Wirtschaftslage zu einer Ausweitung der Investitionen (vgl. Abbildung 10: Alle Projekte, auch |41|die Projekte A und B werden rentabel und deshalb umgesetzt). Zudem nehmen die Konsumausgaben zu, da die Ersparnisbildung der Wirtschaftssubjekte aufgrund der gesunkenen Zinsen weniger rentabel ist. Es kommt zu einem Aufschwung. Wenn in dieser Situation die Geschäftsbanken die Kreditvergabe nicht ausweiten können oder diese gar wegen zunehmender Risiken einschränken, kommt es zu einem Anstieg des Zinsniveaus. Es nehmen damit sowohl die Finanzierungskosten der Investoren zu als auch die Kontokorrentzinsen, die für die Nachfrager bedeutsam sind. In der Folge geht die Nachfrage zurück. Die Preise fallen. Die Gewinne der Unternehmen sinken. Die Investitionen werden eingeschränkt und damit die Beschäftigung. Schließlich fällt die Kaufkraft aufgrund der gesunkenen Lohnsumme. Die Wirtschaft gleitet in die Rezession. Ein Beispiel für eine kreditinduzierte Rezession ist die Finanzkrise, die 1997/ 1998 in Asien durch eine zunächst viel zu expansive Kreditpolitik des dortigen Bankensektors verursacht wurde.
Hintergrund dieser Erklärung konjunktureller Schwankungen ist die Annahme, dass Konjunkturzyklen parallel zu Produktlebenszyklen von Produkten verlaufen, die besonders beschäftigungsintensiv produziert werden. Joseph Schumpeter (1883–1950) ging davon aus, dass sich eine Produktinnovation eines Unternehmers als technologische Neuerung auf dem Markt durchsetzen kann. Die Wirtschaft gerät in einen Aufschwung, da immer mehr Unternehmen die Innovation, indem sie vermehrt investieren, nachahmen. Dieser Prozess geht so lange von statten, bis so viele Neuunternehmer auf dem Markt sind, dass der Gewinn des einzelnen Unternehmens zurückgeht. Der erzielbare Preis für das Produkt liegt dann nicht nur kurz- sondern mittelfristig unterhalb der Grenzkosten der Produktion, d.h. für den Unternehmer lohnt sich die Produktion nicht mehr. Sinkende Gewinne oder gar Verluste leiten jedoch unter Umständen einen Abschwung ein, dem durch eine sich erneuernde Innovationsfähigkeit der Volkswirtschaft begegnet werden kann.
Eine weitere Sichtweise hinsichtlich der Gründe für Konjunkturschwankungen lieferte Arthur C. Pigou (1877–1959) im Jahr 1927. Er machte das Verhalten der Marktteilnehmer verantwortlich für Konjunkturschwankungen. Übertriebener Optimismus der Investoren führt zu z.T. risikobehafteten Investitionsentscheidungen und damit zu einem angebotsinduzierten Aufschwung, der bei einer neutralen Sicht auf die Wirtschaftsentwicklung unter Umständen nicht stattgefunden hätte. Wenn sich die Absatzerwartungen der Unternehmer nun nicht erfüllen, kommt es zu einer stark gegenläufigen Kontraktionsphase. Die Unternehmen bauen Kapazitäten über die Maßen ab. Die Beschäftigung geht zurück. Die Kaufkraft fällt weiter. Denkbar ist auch, dass der Optimismus der Konsumenten einen nachfrageinduzierten Aufschwung einleitet. In der Erwartung zunehmender Beschäftigung sowie steigender Löhne und Gehälter wird der Konsum ausgedehnt. Stellen sich die Erwartungen als fehlerhaft heraus, steigen die Löhne und Gehälter nicht im erhofften Ausmaß. Der Konsum wird zurückgenommen. Die anfänglich positive Erwartung schlägt in eine Rezession um (Teichmann 1997, 7ff).
Ein Konjunkturzyklus kann auch ohne jegliche kausale ökonomische Notwendigkeit herbeigeredet werden. In dem Augenblick, in dem die Medien und einflussreiche Wirtschaftssubjekte mit einem wirtschaftlichen Einbruch rechnen und öffentlich |42|darüber reden, beginnen die Empfänger der Informationen zu sparen, weniger zu investieren bzw. zu konsumieren. Andersherum kann auch ein Aufschwung herbeigeredet werden. Wird eine neue, als wirtschaftskompetent geltende Regierung gewählt, investieren die Unternehmen, um die Konsumenten künftig bedienen zu können. Diese kaufen auch auf Kreditbasis Güter, da sie mit Lohn- und Gehaltssteigerungen rechnen und andererseits Preissteigerungen erwarten. Diese Art von Konjunkturschwankungen wird durch sich selbst erfüllende Prophezeiungen induziert.
Sowohl die Unterkonsumtions- als auch die Überinvestitionstheorie und die zur Auflösung der konjunkturellen Verzerrung empfohlenen Instrumente werden heute überwiegend als überholt angesehen, helfen uns jedoch, die Prozesse besser zu verstehen. Die Konturen der Zyklen sind heute aufgrund der statistischen Datenerhebungs- und Analysemöglichkeiten deutlicher zu erkennen. Der technische Fortschritt erfolgt aufgrund der Globalisierung heute weniger in „plötzlichen“ Schüben als vielmehr relativ gleichmäßig. Es werden von dieser Seite heute eher keine Konjunkturzyklen ausgelöst.
2.4.2 Keynesianische Konjunkturmodelle
Zwei einfache Modelle zur Erklärung von Konjunkturschwankungen basieren auf der keynesianischen Theorie. Es sind die Modelle von John R. Hicks (1904–1989) und Paul A. Samuelson (1915–2009) (vgl. dazu z.B. Heubes 1991, 29–83 sowie Teichmann 1997, 11–14). Samuelson betrachtete in seinem Modell eine geschlossene Volkswirtschaft, d.h. das Export- und das Importverhalten der Unternehmen und privaten Haushalte bleiben außer Acht. Das BIP Y wird demnach für den Konsum der privaten Haushalte C H, die Investitionen I und den Staatskonsum C Gverwendet. Das Preisniveau nimmt Samuelson als gegeben an, d.h. es wird nicht durch die genannten Größen beeinflusst. Der Produktionsfaktor Arbeit ist bei dieser Betrachtung ausreichend vorhanden. Der Produktionsfaktor Kapital stellt hingegen einen Engpass dar. Die Produktionsfaktoren werden beide im Produktionsprozess benötigt und können nicht durch den jeweils anderen ersetzt werden. Jede zusätzlich im Produktionsprozess eingebrachte Einheit Kapital erfordert eine bzw. mehrere zusätzliche Einheiten Arbeit und anders herum. Diese Annahme ist durchaus realistisch: man stelle sich ein neu angeschafftes Fließband vor, an dem nur unter besonderen Umständen Güter produziert werden können, ohne dass eine zusätzliche Arbeitskraft zum Einsatz kommt. Samuelson geht in diesem Modell davon aus, dass Konjunkturschwankungen durch Veränderungen des Verhältnisses der Investitionen I zum Output Y verstärkt werden. Steigen die Investitionen um eine Einheit, so ist zu erwarten, dass der Output entsprechend um zwei bis zu drei Einheiten, also überproportional zunimmt. Der Grund: Die Investitionen selbst erhöhen die Nachfrage des Unternehmens nach Zulieferprodukten, die weiterverarbeitet werden können, und damit werden Investitionen in weiteren Unternehmen notwendig. Die Investitionen wirken wie ein Akzelerator und dieser wird – wenn wir einmal die Annahme der geschlossenen Volkswirtschaft außer Acht lassen – nicht ausschließlich im Inland wirksam.[26] So waren 2015 in Deutschland rund |43|16 Prozent der Exportgüter chemische Erzeugnisse und etwa 13 Prozent der Importe (German Trade and Invest 2016). Auch zum Konsum C Htrifft Samuelson verschiedene Annahmen: Die Konsumfunktion basiert auf den Annahmen von John M. Keynes’ makroökonomischem Modell zur Begründung der Notwendigkeit höherer Staatsausgaben in wirtschaftlichen Krisensituationen (Felderer 2005). Der Konsum C Hder privaten Haushalte ist diesem zufolge vom Einkommen der Vorperiode abhängig. Dieses wiederum wird entweder gespart oder ausgegeben, je nachdem wie groß die Konsumneigung c bzw. die Sparneigung s ist. Konsumneigung und Sparneigung ergeben in der Summe immer 1, d.h. der Wert z.B. der Konsumneigung liegt zwischen 0 und 1. Wenn die Konsumneigung c 0,8 beträgt, werden 80 Prozent des verfügbaren Einkommens für Konsumzwecke verausgabt, und 20 Prozent gespart. Wenn die Konsumneigung von 0,8 auf 0,9 steigt, dann geht die Ersparnis zwar um 10 Prozentpunkte zurück, aber durch den zusätzlichen Konsum nimmt nicht nur die aktuelle Güternachfrage zu, sondern es steigen zudem die Investitionen. D.h., da die laufende Investitionsnachfrage sich – anders als die einkommensunabhängige autonome Investitionsnachfrage – proportional zum Konsum C Hverhält, werden zusätzliche Investitionen getätigt und damit künftige Produktionskapazitäten geschaffen, um Nachfragesteigerungen bedienen zu können. Dies wiederum bewirkt, dass zusätzliche Arbeitseinheiten in den Produktionsprozess eingebracht werden müssen. Die Entlohnung des Produktionsfaktors Arbeit zieht gesamtwirtschaftlich ein höheres Einkommen nach sich. Ein höheres Einkommen seinerseits bewirkt, dass die Konsumausgaben, die annahmegemäß einkommensabhängig sind, steigen. Es liegt demnach ein doppelter Effekt vor, der durch die Konsumneigung hervorgerufen wird. Daraus resultiert der Begriff Multiplikator.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.