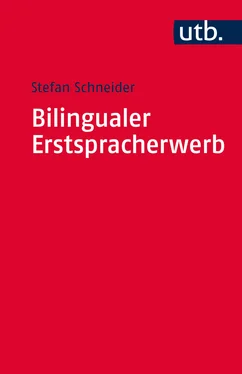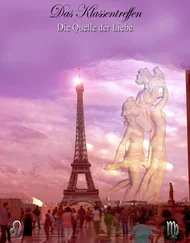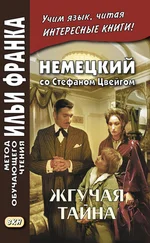Die Beobachtung der Kinder und die Registrierung ihrer sprachlichen Kompetenzen kann ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen, zwei Methoden sind jedoch für Langzeituntersuchungen charakteristisch: Während die ersten Studien auf Tagebucheinträgen beruhten, stammt heutzutage ein Großteil der Daten von Audio- und/oder Videoaufnahmen. In jedem Fall, egal ob es sich um einfache Tagebucheinträge oder technisch anspruchsvolle Videoaufnahmen handelt, besteht ein im Prinzip unüberwindliches methodologisches Problem, das bekannte observer’s paradox:
The aim of the linguistic research in the community must be to find out how people talk when they are not being systematically observed; yet we can only obtain these data by systematic observation. (Labov 1972, 209)
‚Das Ziel der sprachwissenschaftlichen Forschung in der Sprechergemeinschaft muss sein herauszufinden, wie Menschen sprechen, wenn sie nicht systematisch beobachtet werden; doch wir können diesen Daten nur durch systematische Beobachtung erlangen.‘
Eine Konversation, die dadurch unterbrochen und eben auch verändert wird, dass der Forscher oder die Forscherin eine Äußerung des Kindes in das Tagebuch einträgt, ist ein typisches Beispiel für diese paradoxe Situation.
Tagebucheinträge hängen vom jeweiligen registrierungswürdigen Ereignis ab und erfolgen deshalb notwendigerweise in unregelmäßigen Zeitintervallen. Daten aus Tagebüchern beinhalten immer ein bestimmtes Maß an Subjektivität (McLaughlin 1978, 73). Ungewöhnliche oder nicht der Norm entsprechende Äußerungen werden mit größerer Wahrscheinlichkeit festgehalten als korrekte und unauffällige. Aus diesem Grund sind Tagebucheinträge weder repräsentativ noch für quantitative Rückschlüsse geeignet. Detaillierte und verlässliche Tagebucheinträge stellen jedoch eine wertvolle Ergänzung der Audio- und Videodaten dar. Seltene Phänomene, die in den Aufnahmen nicht zu Tage treten, können auf diese Weise erfasst und beschrieben werden. Yip und Matthews (2007, 72) weisen z. B. darauf hin, dass Relativsätze in ihren Aufnahmen kaum aufscheinen und die spezielle Entwicklung der pränominalen Relativsätze nur dank der Tagebucheinträge nachvollzogen werden kann.
Um speziell die Entwicklung des Wortschatzes festzuhalten, wird in heutigen Studien gelegentlich ein Lexikontagebuch geführt (Deuchar und Quay 2000; Klammler 2006; Klammler und Schneider 2011), in das die Eltern, wenn möglich täglich, die neuen Wörter des bilingualen Kindes eintragen. Die Tabelle 1zeigt die Einträge im Alter von 1;4;11 aus Deuchar und Quay (2000, 15). Es gibt für solche Tagebücher kein spezielles Format. Entscheidend ist lediglich, dass die Eltern oder andere Beteiligte darin das Alter, das vom Kind verwendete Wort, die phonetische Transkription, die Bedeutung oder Bedeutungen des Wortes und Informationen zum außersprachlichen Kontext vermerken. Statt die Wörter des Kindes nach einer der beiden Sprachen zu klassifizieren, ist es sinnvoller, die Sprache der Gesprächspartner und -partnerinnen zu vermerken. Dadurch kann man später nachzeichnen, ob und wie sich das Kind an der Sprache der Gesprächspartner und -partnerinnen orientiert. Eine Klassifikation der Wörter nach Sprache ist hingegen oft schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, da viele Wörter (onomatopoetische oder lautmalerische Wörter, in beiden Sprachen gleichlautende Wörter, Eigennamen) in beiden Sprachen verwendet werden. Überdies enthalten besonders in den frühen Phasen des Spracherwerbs die Wörter der Kinder zumeist nur eine oder zwei Silben, was die Zuordnung zusätzlich erschwert (De Houwer 2009, 178). Wie man an den Tabellen 2 und 3 in Kapitel 5sehen kann, sahen sich Volterra und Taeschner (1978) deshalb gezwungen, eine zusätzliche Kategorie anzulegen (Gawlitzek-Maiwald und Tracy 1996, 909; Klammler und Schneider 2011).
Tab. 1: Einträge, Lexikontagebuch im Alter von 1;4;11 (Deuchar und Quay 2000, 15)
| Situation |
Word |
Gloss |
Pronunciation |
Additional information |
Language of adult |
| breakfast at home |
gone |
|
[gɔ:] |
on finishing her cereal and juice |
Spanish |
| breakfast at home |
bajar |
get down |
[ba] |
wanting to get down from her highchair |
Spanish |
| at home after breakfast |
panda |
|
[pa] |
bringing mother a book showing panda |
Spanish |
| leaving the house |
casa |
house |
[ka] |
pointing at the house from outside |
Spanish |
| lunchtime at university |
zapato |
shoe |
[pa] |
referring to her shoe |
English |
| arriving home |
casa |
house |
[ka] |
outside the house |
Spanish |
| at home |
más |
more |
[ma] |
wanting more of something |
Spanish |
| at home |
bajar |
get down |
[ba] |
wanting to get down |
Spanish |
Audio- und Videoaufnahmen finden in regelmäßigen Zeitintervallen statt. Der subjektive Faktor bei der Auswahl der zu beschreibenden Phänomene wird dadurch vermieden und die Daten können zu quantitativen und statistischen Zwecken herangezogen werden. Je kürzer die Intervalle sind und je länger die Aufnahmen, desto genauer und zuverlässiger ist selbstverständlich die Datenerfassung. Aufgrund vieler objektiver Beschränkungen, wie z. B. zeitliche Verfügbarkeit und Bereitschaft der Kinder und ihrer Eltern, verfügbare Räumlichkeiten, verfügbare technische Ausrüstung oder Dauer der Transkriptionsarbeit, liegen wöchentliche Aufnahmen im Ausmaß von einer Stunde schon an der oberen Grenze der Machbarkeit. Bei einer sich über ein oder zwei Jahre erstreckenden Beobachtungszeit ist die Menge der zu bearbeitenden und analysierenden Daten schon so enorm, dass sie im Normalfall auch bei einem einzigen beobachteten Kind nur von einer Forschergruppe bewältigt werden kann. Aber auch diese Daten können nur einen Bruchteil der kindlichen Äußerungen dokumentieren. Tomasello und Stahl (2004) schätzen, dass die im CHILDES-Datenbanksystem verfügbaren Aufnahmen jeweils nur ca. 1 % der vom Kind produzierten und gehörten Sprache erfassen. Häufige Sprachstrukturen treten in solchen Daten sicherlich an den Tag, seltene Erscheinungen können hingegen auch nach stundenlangen Aufnahmen fehlen, weshalb ich vorhin auf den Nutzen verlässlicher Tagebucheinträge hingewiesen habe. Die Dauer der Intervalle und Aufnahmen erweist sich dann als besonders wichtig, wenn bei Überlegungen zum Entwicklungsverlauf der Zeitpunkt des ersten Auftauchens einer Sprachstruktur bestimmt werden soll (Yip und Matthews 2007, 61).
Die Aufnahme spontaner kindlicher Sprachäußerungen muss sorgfältig geplant und vorbereitet werden. Die Umgebung und das Setting sollten kindgerecht und vor allem natürlich sein. Speziell dafür eingerichtete Räumlichkeiten bringen zwar technische Vorteile, stellen meistens jedoch im Unterschied zum gewohnten Spielzimmer des Kindes eine neue Umgebung dar. Wichtig ist eine ungezwungene Atmosphäre, da Kinder rasch herausbekommen, dass sie im Mittelpunkt des Geschehens stehen, und die Erhebung dadurch verfälscht werden kann. Bei bilingualen Kindern sollten je Sprache unterschiedliche Gesprächspartner und -partnerinnen zur Verfügung stehen. Diese sind idealerweise Personen, mit denen das Kind gewöhnlich Umgang hat und mit denen es vertraut ist (Mutter, Vater, größere Geschwister, enge Verwandte oder Freunde). Neue, ungewohnte Personen können das kindliche Sprachverhalten beeinflussen. Aus diesem Grund ist die Anwesenheit des Forschers oder der Forscherin nur in Ausnahmefällen empfehlenswert. Wenn es technisch und organisatorisch machbar ist, sollte man deshalb die jeweiligen Gesprächspartner und -partnerinnen bezüglich Aufnahmedauer, -intervall und -modus unterweisen und ihnen danach die Aufnahme ganz überlassen, wie das in den Studien von Lanza (1997), Klammler (2006) und Koroschetz (2008) gehandhabt wurde.
Читать дальше