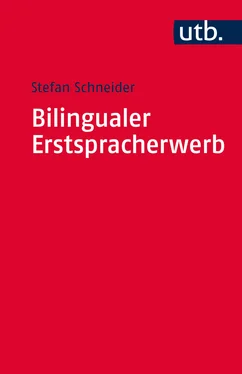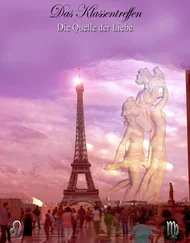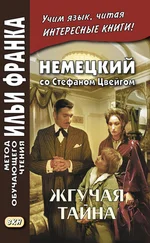Stefan Schneider - Bilingualer Erstspracherwerb
Здесь есть возможность читать онлайн «Stefan Schneider - Bilingualer Erstspracherwerb» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bilingualer Erstspracherwerb
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bilingualer Erstspracherwerb: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bilingualer Erstspracherwerb»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Bilingualer Erstspracherwerb — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bilingualer Erstspracherwerb», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Von Relevanz für den bilingualen Erstspracherwerb ist auch die von Paradis (1984, 1985, 1993, 2004, 2007) vorgeschlagene activation threshold hypothesis, die zu erklären versucht, wie mehrsprachige Individuen Sprache verarbeiten. Die Grundidee dieser psycho- und neurolinguistischen Hypothese ist, dass die Verfügbarkeit sprachlicher Elemente von der Häufigkeit ihrer Aktivierung und dem Zeitabstand zur letzten Aktivierung abhängt. Ein sprachliches Element wird erst dann aktiviert, wenn eine ausreichende Anzahl positiver neuronaler Impulse vorhanden ist. Diese Anzahl stellt die Aktivierungsschwelle dar (Paradis 1993, 138, 2004, 28). Die Schwelle ist dauernder Variation unterworfen. Jedes Mal wenn ein Element aktiviert wird, sinkt die Schwelle und weniger Impulse sind zu seiner Reaktivierung notwendig. Wenn jedoch ein Element über längere Zeit nicht reaktiviert wird, erhöht sich die Schwelle wieder. Je länger ein Element nicht aktiviert wird, desto höher steigt die Schwelle. Die Aktivierung eines neuronalen Elements hat zur Folge, dass sich die Aktivierungsschwelle potentieller Mitbewerber automatisch erhöht. Paradis (1993, 138, 2004, 28) spricht hier von Inhibition. Für das bilinguale Individuum bedeutet dies, dass durch die Aktivierung einer Sprache die Schwelle der zweiten Sprache erhöht wird, um Interferenzen zu unterdrücken. Der intensive Kontakt mit einer Sprache vermindert die Aktivierungsschwelle dieser Sprache und erhöht gleichzeitig die Schwelle der zweiten Sprache, wodurch sich in letzterer Sprachabbauphänomene wie Sprachmischung, Wortfindungsschwierigkeiten und so fort manifestieren können (Paradis 2007, 125–129). Die Hypothese ist zweifelsohne attraktiv, weil sie für den subjektiven Eindruck vieler multilingualer Sprecher und Sprecherinnen, die verminderte Verwendung eine ihrer Sprachen erschwere den Zugriff auf sie, eine theoretische neurolinguistische Erklärung bietet. Allerdings fehlen bis heute Studien, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der verminderten Intensität des Kontaktes mit einer Sprache und ihrem Abbau nachweisen können (Dostert 2009, 47).
In der Forschung zum monolingualen Spracherwerb wird oft die Frage gestellt, wie es möglich ist, dass Kinder mit solch einer erstaunlichen Schnelligkeit neue Wörter lernen. Oftmals kennen sie ein neues Wort nach nur einmaligem Hören. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass Kinder sich an kognitiven Leitlinien orientieren, welche die möglichen Wortbedeutungen einschränken (Tomasello 2003b, 84–87). Mit anderen Worten, Kinder würden beim Bedeutungserwerb dank kognitiver Prinzipien eine bestimmte Wortinterpretation einer anderen vorziehen. Zwei Prinzipien dieser Art könnten sein, dass sich ein Wort auf eine Klasse von Objekten bezieht, die sich gleichen, und dass sich ein Wort auf ein ganzes Objekt und nicht auf Teile davon bezieht (whole object assumption). Das bekannteste diesbezügliche Prinzip ist jedoch das principle of contrast (Clark 1987). Die von Markman und Wachtel (1988) angenommene mutual exclusivity assumption, im Deutschen Ausschließlichkeitsprinzip genannt (Szagun 2006, 145), bezeichnet zwar nicht genau das Gleiche, steht damit jedoch in engem Zusammenhang. Es handelt sich um die Annahme, laut der „any difference in form in a language marks a difference in meaning“ (Clark 1987, 2). Die Anwendung des Prinzips erleichtert den Kindern den Erwerb neuer Wörter, da es die möglichen Hypothesen über ihre Bedeutung einschränkt. Kinder nehmen beim Erwerb neuer Wörter an, dass sich zwei Wörter nicht auf das gleiche Objekt beziehen. Laut Clark (1987, 12) führt das allerdings dazu, dass Kinder anfangs Schwierigkeiten bei der semantischen Beziehung zwischen Unterbegriff und Oberbegriff haben. Wenn beispielsweise ein Erwachsener auf einen Hund zeigt und sagt Das ist ein Tier, wenden zwei- und dreijährige Kinder ein Nein, das ist ein Hund. Clark (1987, 13) nimmt an, dass das Kontrastprinzip auch bei bilingualen Kindern wirksam ist und in den Anfangsphasen des Spracherwerbs zur Vermeidung von Äquivalenten oder interlingualen Synonymen führt:
Young bilingual children face a similar problem. In the earliest stages of acquisition, they often accept only one label for a category despite exposure to a label from each language [...]. The result, from the young child’s point of view, is a single lexicon in which all terms should contrast.
‚Kleine zweisprachige Kinder stehen einem ähnlichen Problem gegenüber. In den frühesten Erwerbsphasen akzeptieren sie oft nur ein Etikett für eine Kategorie, obwohl sie in jeder Sprache mit einem Etikett konfrontiert sind [...]. Das Ergebnis ist, vom Standpunkt des Kindes, ein einziger Wortschatz, in dem alle Wörter zueinander in Opposition stehen.‘
Bilinguale Kinder würden jedoch früher als monolinguale Kinder zwei Wörter für das gleiche Objekt akzeptieren. Ab einem Wortschatz von 150 Wörtern würden sie merken, dass sie es mit zwei verschiedenen Sprachsystemen zu tun haben und das Kontrastprinzip nur innerhalb einer Sprache und nicht sprachübergreifend wirksam ist. In Clark (1993, 98) wird diese Grenze sogar auf 50 Wörter gesenkt. Es gibt allerdings Daten, sowohl von monolingualen als auch von bilingualen Kindern, die gegen das Kontrastprinzip sprechen. Blewitt (1994) weist nach, dass zwei- und dreijährige Kinder unter bestimmten Testbedingungen sehr wohl zwei Bezeichnungen für ein Objekt zulassen und gleichzeitig spezifische Unterbegriffe und Oberbegriffe akzeptieren (Tomasello 2003b, 73, 86). Eine Schildkröte kann also eine Schildkröte und ein Tier sein. Zwei- und dreijährige Kinder scheinen schon ein elementares Verständnis von semantischen Hierarchien zu haben. Die Erkenntnisse über Äquivalente im frühen bilingualen Erstspracherwerb stellen das Kontrastprinzip ebenfalls in Frage. Wie zahlreiche Studien nachweisen, treten Äquivalente auf, sobald zu Beginn des zweiten Lebensjahres die ersten Wörter und Holophrasen (Einwortäußerungen) produziert werden. Deuchar und Quay (2000, 59) stellen beispielsweise bei dem von ihnen beobachteten Kind im Alter von 0;10 bis 1;10 eine ganze Reihe von Äquivalenten fest und schließen daraus, dass das Kontrastprinzip in diesem Fall nicht zutreffen könne. Nur unter der Annahme, dass bilinguale Kinder von Beginn an über zwei getrennte Sprachsysteme verfügen, könne man das Kontrastprinzip aufrechterhalten (2000, 62).
3.3 Untersuchungs- und Forschungsmethoden
Die Daten, die zur Analyse der Fragestellungen und zur Überprüfung der Hypothesen herangezogen werden, stammen aus allen Bereichen der kommunikativen Kompetenz mehrsprachiger Kinder. Die ‚klassischen‘ Studien beschäftigten sich vornehmlich mit der Morphologie, der Syntax und dem Lexikon, seltener mit der Phonologie, wobei diese Bereiche recht isoliert voneinander betrachtet wurden. Auch neuere Untersuchungen fokussieren zumeist einzelne Bereiche, versuchen jedoch, diese innerhalb des gesamten kommunikativen Verhaltens vernetzt zu betrachten und zu analysieren.
Die in der Forschung zum bilingualen Erstspracherwerb eingesetzten Untersuchungsmethoden gehören zum gängigen Repertoire der Spracherwerbsforschung, der Psycholinguistik im Allgemeinen, der Neurolinguistik und teilweise auch der Soziolinguistik. Grundsätzlich kann man zwischen zwei Methoden oder empirischen Ansätzen unterscheiden, der Langzeituntersuchung und der Querschnittuntersuchung.
Die meisten der in den beiden nächsten Kapiteln beschriebenen Studien, etwa diejenigen von Ronjat (1913) oder Leopold (1939–1949), stellen den typischen Fall einer Langzeit-, Longitudinal- oder Längsschnittuntersuchung dar. In einer solchen Untersuchung wird der bilinguale Spracherwerb zumeist eines Kindes, seltener mehrerer Kinder, während eines bestimmten, manchmal jahrelangen Zeitraums systematisch beobachtet und registriert. Eine Langzeituntersuchung ist ein aufwändiges und arbeitsintensives Unterfangen, das einen oder mehrere Forscher und Forscherinnen über Jahre hinweg beschäftigt. Daher beschränken sich die meisten dieser Untersuchungen auf ein Kind oder günstigenfalls auf eine kleine Anzahl von Kindern. Da es sich um die Untersuchung einzelner Kinder, also einzelner Fälle handelt, spricht man auch von einer Fallstudie, im Englischen case study. Langzeituntersuchungen liefern ein genaues Bild der sprachlichen Entwicklung eines bilingualen Kindes. Dieser Umstand begünstigt die Formulierung von Hypothesen zum bilingualen Erstspracherwerb. Wie Yip und Matthews (2007, 57 f.) unterstreichen, stammen die meisten neueren Hypothesen und Theorien von Langzeituntersuchungen. Da diese Einzelfälle dokumentieren, sind sie jedoch bezüglich der allgemeinen Gültigkeit eines bestimmten Entwicklungsstadiums weniger aussagekräftig. Doch Forschungsergebnisse kumulieren sich und die Resultate einer einzelnen Langzeituntersuchung können jederzeit mit denjenigen vorhergehender Untersuchungen verglichen werden. Mit anderen Worten, eine Fallstudie dokumentiert zwar einen einzelnen Fall, findet jedoch nicht in Isolation, sondern vor dem Hintergrund anderer Untersuchungen statt (Deuchar und Quay 2000, 2).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bilingualer Erstspracherwerb»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bilingualer Erstspracherwerb» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bilingualer Erstspracherwerb» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.