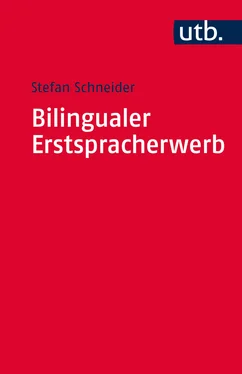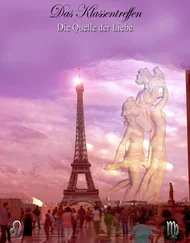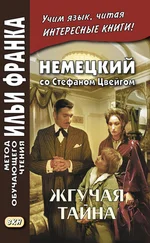Zur Transkription gesprochener Sprache gibt es eine ganze Reihe erprobter Verfahren und Formate. In der Spracherwerbsforschung werden die Aufnahmen zumeist gemäß dem CHAT-Format (Codes for the human analysis of transcripts) transkribiert und annotiert. Es handelt sich um ein Format, das für die Transkription gesprochener Sprache nicht unbedingt das geeignetste ist. Denn wie bei jedem vertikalen oder sequenziellen Transkriptionsformat kann das gleichzeitige Sprechen von zwei oder mehreren Gesprächsteilnehmern nur schwer dargestellt werden. Das CHAT-Format sieht darüber hinaus für jede Äußerung eine neue Zeile vor und zwingt dadurch automatisch zu einer Segmentierung in Redeeinheiten. CHAT wird deshalb bei der Transkription von Gesprächen zwischen Erwachsenen selten angewendet (eine der wenigen Ausnahmen ist das C-ORAL-ROM-Corpus; Cresti und Moneglia 2005). Es hat aber in der Forschung zum mono- und bilingualen Spracherwerb große Verbreitung und kann als Standard betrachtet werden. Das Format wurde im Rahmen des CHILDES-Datenbanksystems (Child language data exchange system; http://childes.psy.cmu.edu/; MacWhinney 2000) entwickelt, das an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh betrieben wird. Es ist verhältnismäßig leicht zu handhaben und wird durch spezielle Software und ausführliche Handbücher unterstützt. CHAT-konforme Transkripte können mit dem CLAN-Programm (Computerized language analysis) systematisch durchsucht werden. Der größte Vorteil des Formates ist die Möglichkeit, die standardisierten Transkripte nach Rücksprache mit den Administratoren in die Datenbank hochzuladen. Diese stehen dadurch der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur freien Konsultation zur Verfügung. Das CHILDES-Datenbanksystem enthält zurzeit mehr als 130 Korpora, d. h. Sammlungen von Aufnahmen, die nach einheitlichen Standards aus vielen verschiedenen Einzelsprachen erhoben wurden.
Ein Transkript im CHAT-Format besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen ( Abbildungen 2, 3und 7). Der Transkriptkopf (header) enthält auf mehreren Zeilen, die alle mit dem @-Zeichen beginnen, Informationen über die Sprache, die Gesprächsteilnehmer, die Zeit, den Ort, die Aufnahmesituation und Ähnliches. Das eigentliche Transkript beginnt danach und enthält Zeilen mit dem *-Zeichen, gefolgt von der Abkürzung für die einzelnen Teilnehmer und von ihren Äußerungen. Erläuterungen zur Äußerungssituation, zu Elementen nonverbaler Kommunikation und zu anderen Faktoren werden in den von einem %-Zeichen und Abkürzungen eingeleiteten Kommentarzeilen unmittelbar unter eine Äußerungszeile geschrieben ( Abbildung 3). Durch die Abkürzungen werden die Kommentare bestimmten Kategorien zugeordnet. Die Abkürzung sit z. B. bedeutet, dass es sich um eine situationsbezogene Information handelt, mit gls werden Glossen oder Übersetzungen angezeigt.
| @Loc: |
Biling/Koroschetz/2de.cha |
| @Languages: |
deu |
| @Participants: |
CHI Manuel Target_Child, MOT Doris Mother |
| @ID: |
deu|koroschetz|CHI|2;10.14|male|||Target_Child||| |
| @ID: |
deu|koroschetz|MOT|||||Mother||| |
| @Transcriber: |
Carina |
| @Date: |
09-JUN-2007 |
| @Location: |
Naples, Campania, Italy |
| @Situation: |
free playing with mother |
| *MOT: |
was willst du machen? |
| *MOT: |
die Schachtel willst du aufmachen? |
| *MOT: |
schaffst dus [: du es] alleine oder soll die Mama helfen? |
| *CHI: |
die Mama soll. |
| *MOT: |
hmm, was soll die Mama machen. |
| *CHI: |
sitz oben. |
| *MOT: |
wo sitzt du? |
| *MOT: |
was isn [: ist denn] das? |
| *CHI: |
ein Polster. |
| *MOT: |
ein Polster, was für ein Poster? |
| *CHI: |
von Winnie Puh. |
| *MOT: |
wie gehtn [: geht denn] das auf? |
| *MOT: |
schau auf der Seite macht man das auf, schau so. |
| *MOT: |
und was is(t) da drinnen? |
| *CHI: |
ein Zettel und ein +... |
| *MOT: |
das is(t) leer, die Schachtel ist nicht interessant, hmm? |
| *MOT: |
die machma [: machen wir] wieder zu. |
| *MOT: |
wart komm her, die Mama hilft dir. |
| *CHI: |
ein Zettel. |
| *MOT: |
so, und was spielma [: spielen wir] jetzt schönes? |
| *MOT: |
hmm, was magstn [: magst du denn] machen? |
| *CHI: |
tu jetz ein Pini machen. |
| *MOT: |
ein Picknick möchtest du machen? |
| *CHI: |
ein zest. |
| *MOT: |
ein Fest? |
| *CHI: |
ja. |
| *MOT: |
was für ein Fest? |
| *CHI: |
das ist ein Pinit. |
| [...] |
|
| @End |
|
Abb. 2: Transkript im CHAT-Format (Koroschetz 2008 und http://childes.psy.cmu.edu)
| @Loc: |
Biling/Koroschetz/1it.cha |
| @Languages: |
ita |
| @Participants: |
CHI Manuel Target_Child, FAT Gianni Father, MOT Doris Mother |
| @ID: |
ita|koroschetz|CHI|2;9.13|male|||Target_Child||| |
| @ID: |
ita|koroschetz|FAT|||||Father||| |
| @ID: |
ita|koroschetz|MOT|||||Mother||| |
| @Media: |
1it, audio |
| @Transcriber: |
Carina |
| @Date: |
09-MAY-2007 |
| @Location: |
Naples, Campania, Italy |
| @Situation: |
free playing with father, reading a book |
| *FAT: |
che c’è? |
| *CHI: |
lila mamma. |
| %sit: |
The mother is sometimes present during the recording. |
| *FAT: |
lila? |
| *FAT: |
che cosa c’è di lila? |
| *CHI: |
le lil, le lil. |
| *FAT: |
ha, che cosa cerchiamo di lila? |
| *FAT: |
che cosa stiamo faccendo? |
| *CHI: |
so lila montare. |
| *FAT: |
montare lila cosa? |
| *CHI: |
lila dinari. |
| %gls: |
lila binario. |
| *FAT: |
lila? |
| *CHI: |
denari. |
| %gls: |
binari. |
| *FAT: |
denari? |
| *CHI: |
binari. |
| *FAT: |
binari! |
| *CHI: |
si. |
| *FAT: |
i binari lila, hoho. |
| *FAT: |
ma riusciamo a chiudere secondo te? |
| *CHI: |
si. |
| *FAT: |
pure secondo me riusciamo a chiudere bene. |
| *CHI: |
si. |
| *FAT: |
hoho, adesso che abbiamo chiuso ma che facciamo? |
| *CHI: |
camminare xxx su le lila con la lila binara. |
| [...] |
|
| @End |
|
Abb. 3: Transkript im CHAT-Format (Koroschetz 2008 und http://childes.psy.cmu.edu)
Die Mehrzahl der in den Kapiteln 4und 5beschriebenen Studien sind nicht nur Langzeituntersuchungen, es sind auch Studien, in denen die Sprachentwicklung der eigenen Kinder beobachtet wurde. Die Tatsache, dass Eltern und beobachtende Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen in einer Person vereint sind, beinhaltet zweifelsohne eine Reihe von Vorteilen. Diese Personen genießen einen privilegierten und unkomplizierten Zugang zu den Kindern und haben genaue Kenntnis ihrer Lebensumstände und ihres sozialen Umfelds. Probleme betreffend Privatsphäre und Datenschutz sind einfacher zu lösen. Das Erstellen eines Lexikontagebuchs wird erleichtert, da die dafür notwendigen täglichen Beobachtungen ohnehin nur von den Eltern gemacht werden können. Die Nachteile dieser Methode dürfen jedoch nicht verschwiegen bleiben. Die Gefahr der Subjektivität ist erheblich, etwa bei der Auswahl der Einträge in das Lexikontagebuch (McLaughlin 1978, 73). Eltern tendieren zudem eher dazu, den Kindern ein größeres Wissen zuzuschreiben, als sie tatsächlich an den Tag legen (rich interpretation of data), und Kinderdaten in Kategorien der Erwachsenensprache zu fassen. Wie Deuchar und Quay (2000, 4), Garlin (2008 [2000], 45) und Yip und Matthews (2007, 7) meinen, überwiegen dennoch die Vorteile dieser Methode gegenüber ihren Nachteilen.
Читать дальше