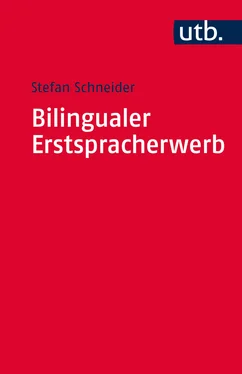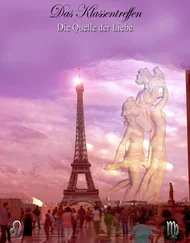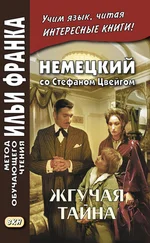Stefan Schneider - Bilingualer Erstspracherwerb
Здесь есть возможность читать онлайн «Stefan Schneider - Bilingualer Erstspracherwerb» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bilingualer Erstspracherwerb
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bilingualer Erstspracherwerb: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bilingualer Erstspracherwerb»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Bilingualer Erstspracherwerb — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bilingualer Erstspracherwerb», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Als zweite grundsätzliche Erhebungsmethode kommt die Querschnittuntersuchung in Frage. Hier handelt es sich um eine Untersuchung, bei der zu einem bestimmten Zeitpunkt die sprachlichen Kompetenzen einer größeren Anzahl von bilingualen Kindern hinsichtlich spezifischer sprachlicher Phänomene erfasst werden. Die Phänomene sind meistens einige wenige oder überhaupt nur ein einzelnes. Eine Reihe von modernen Studien sind Querschnittuntersuchungen. Im Unterschied zur Forschung im monolingualen Erstspracherwerb, in der die meisten der angewendeten empirischen Verfahren entwickelt wurden, sind allerdings diesbezügliche Untersuchungen im bilingualen Erstspracherwerb ungleich aufwändiger. Während eine monolinguale Studie mit einer einzigen Gruppe von Versuchspersonen zu wissenschaftlich fundierten Ergebnissen kommen kann, sind in bilingualen Studien zumindest drei Gruppen notwendig: eine bilinguale Gruppe und je eine monolinguale Gruppe pro Sprache. Die bilinguale Gruppe muss noch dazu zweimal, also einmal pro Sprache, getestet werden. Pro untersuchtem Bereich führt eine solche Erhebung daher zu vier separaten Datensets.
Es ist bei Querschnittstudien entscheidend, dass die an der Untersuchung teilnehmenden Kinder eine möglichst homogene Gruppe in Bezug auf das Alter, den sozialen Hintergrund, das Geschlecht und weitere Faktoren bilden. Meistens wird das sprachliche Phänomen bei den Kindern mit Fragebögen oder Tests erhoben. Aufgrund der Anzahl der getesteten Kinder liefern Querschnittuntersuchungen ein genaues Bild eines momentanen Entwicklungsstadiums. Wenn eine Querschnittuntersuchung mit der gleichen Gruppe von Kindern in regelmäßigen Abständen wiederholt wird, entsteht eine Verbindung zwischen Querschnitt- und Langzeituntersuchung, die die Vorteile beider Untersuchungsverfahren kombiniert. Querschnittuntersuchungen mit altersmäßig gestaffelten Gruppen erlauben auch Rückschlüsse auf die sprachliche Entwicklung.
In der Forschung zum monolingualen Erstspracherwerb wurden in den letzten Jahren eine ganze Reihe von experimentellen Verfahren oder Testmethoden entwickelt, mit denen man die Kompetenzen der Kinder erheben kann. In vielen Erhebungen kommen vorgefertigte Fragebögen zum Einsatz, die dem Forscher oder der Forscherin die Arbeit entscheidend erleichtern. Elternfragebögen oder Elternchecklisten werden regelmäßig verwendet, um den momentanen Stand des Wortschatzes von monolingualen oder bilingualen Kindern zu erheben. Man legt den Eltern Listen von Wörtern vor und diese werden gebeten, anzugeben, welche davon ihr Kind bereits rezeptiv und/oder produktiv beherrscht. Typischerweise beherrscht ein Kind einen bestimmten Prozentsatz der Wörter auf der Liste. Der Prozentsatz wird dann mit dem prozentualen Richtwert verglichen, den Kinder ähnlichen Alters aufgrund von empirischen Untersuchungen normalerweise erreichen.
Der bekannteste Fragebogen, MacArthur communicative development inventories (CDI) genannt (Fenson et al. 1993; Fenson et al. 2006), enthält mehr als 600 Wörter aus verschiedenen semantischen Feldern, die den kindlichen Wortschatz wiedergeben. Er steht inzwischen in einer ganzen Reihe von Sprachen zur Verfügung. Die Eltern müssen lediglich die Wörter markieren, die ihr Kind versteht und produziert oder die es nur versteht, aber nicht aktiv produziert. Die Ergebnisse sind also nach aktivem und passivem Wortschatz klassifizierbar. Ein Fragebogen, der auf einer ähnlichen Methode beruht, aber heutzutage kaum noch zum Einsatz kommt, ist der Language development survey (LDS) (Rescorla 1989). Diese Fragebögen haben eine Reihe von Vorteilen. Sie sind vor allem dann hilfreich, wenn Kinder noch zu jung sind, um ohne Weiteres auf Vokabelfragen zu antworten. Ihr Einsatz ist nicht aufwändig und sie ermöglichen es, unter Mithilfe der Eltern in kurzer Zeit Auskunft über den Wortschatz einer repräsentativen Gruppe von Kindern zu erhalten. Sie sind standardisiert und garantieren somit größtmögliche Vergleichbarkeit. Obwohl am besten für Querschnittuntersuchungen geeignet, können sie auch in Langzeituntersuchungen angewendet werden. Allerdings sollten sie nicht die alleinige Erhebungsmethode darstellen. Überhaupt raten Junker und Stockman (2002, 392), Elternfragebögen, so wie auch andere elterliche Aufzeichnungen, in jedem Fall mit der direkten Beobachtung der Sprachproduktion zu kombinieren bzw. zu ergänzen. Elternchecklisten sind keine exhaustiven Wortschatzlisten, sondern stellen nur eine Auswahl an Wörtern zur Verfügung. Manches alltägliche Wort kann darin fehlen. Das bedeutet, dass die CDI-Elterncheckliste zum Beispiel nicht wirklich die genaue Anzahl der von einem Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt beherrschten Wörter angeben kann (De Houwer, Bornstein und De Coster 2006, 343; David und Wei 2008, 603; De Houwer 2009, 73). Gentner und Boroditsky (2009, 24) merken außerdem an, dass durch diese Methode die Erfassung von Eigennamen verhindert wird, wenn die Eltern nicht explizit auf diesen Umstand aufmerksam gemacht werden.
Um die Sprache von Kindern im Grundschulalter zu erheben, wird oft mit Bildimpulsen oder Bildergeschichten gearbeitet. Diese sind sprachunabhängig (aber meist nicht vollkommen abgekoppelt von einer typisch westlichen Kultur) und können so in jeder beliebigen Sprache abgefragt werden. Die bekannteste und verbreitetste Geschichte ist das Bilderbuch Frog, where are you? (Mayer 1969), das oft einfach Frog story genannt wird. Es eignet sich vor allem zur Analyse der Versprachlichung von temporalen Abläufen und der Strukturierung von Information. Damit wurden bereits zahlreiche Erhebungen durchgeführt (Berman und Slobin 1994; Strömqvist und Verhoeven 2004; Mulec 2013). Einige davon sind in der CHILDES-Datenbank ( http://childes.psy.cmu.edu/) in einem Frog story corpus zusammengefasst.
Im Gegensatz zu den bisher genannten Methoden, die vor allem die Sprachproduktion erheben, wird mit Hilfe des Peabody picture vocabulary test (PPVT) spezifisch das Sprachverständnis gemessen. Es handelt sich um einen bekannten, ursprünglich von Dunn (1959) für das Englische entworfenen Test zur Ermittlung des passiven Wortschatzes. Dunn und Dunn (1981) publizierten eine modifizierte und verbesserte Version des Tests, den Peabody picture vocabulary test-Revised (PPVT-R). Inzwischen existieren noch weitere Überarbeitungen des Tests (PPVT-III; Dunn und Dunn 1997) sowie eine Reihe von Versionen für andere Sprachen. Der Test wird gern als Eingangstest verwendet, um Informationen über den passiven Wortschatz der Probanden zu bekommen und diese verschiedenen Untersuchungsgruppen zuordnen zu können. Die Testungen werden individuell mit dem Kind durchgeführt. Der Test ist rein gestisch, d. h. das Kind muss weder lesen noch schreiben, ja nicht einmal sprechen können. Dem Kind wird ein Blatt mit vier Schwarzweißzeichnungen vorgelegt, während die testende Person ein Wort sagt. Die Aufgabe besteht darin, auf dasjenige Bild zu zeigen, das die Bedeutung des Wortes am besten wiedergibt. Die Kinder können auf die Zeichnung zeigen oder die der Zeichnung entsprechende Zahl sagen. Da gleich am Beginn der Testung das vom Alter des Kindes abhängende Ausgangsniveau ermittelt wird, werden nur diejenigen Wörter gefragt, die über dem altersgemäßen Ausgangsbereich liegen. Somit vermeidet man die Testung von Wörtern, die dem Kind bereits seit Jahren bekannt sind.
In den letzten Jahren werden verstärkt experimentelle Untersuchungen zur Perzeption und Sprachverarbeitung von Neugeborenen und Säuglingen gemacht. Hier kommen selbstverständlich ganz andere Untersuchungstechniken zur Anwendung. Zumeist macht man sich das Blickverhalten oder den Saugrhythmus der Babys zunutze (Klann-Delius 2008; Johnson und Zamuner 2010; Sedivy 2010). Klann-Delius (2008, 16 ff.) unterscheidet drei experimentelle Verfahren. Schon Säuglinge können Objekte und Personen mit dem Blick erfassen und für längere Zeit fixieren. Man spricht von Präferenzparadigma, wenn dem Säugling mehrere Gesichter präsentiert werden und die Fixationsdauer zeigt, ob er das Gesicht der Mutter erkennt. In der englischsprachigen Psycholinguistik verwendet man hier den Ausdruck preferential looking ‚bevorzugte Blickzuwendung‘. Die Methode kann auch abgewandelt werden. Man kann fremde Gesichter mit verschiedenen Stimmen reden lassen, eines davon mit der Stimme der Mutter. Blickt das Baby häufiger auf dieses Gesicht, ist anzunehmen, dass es eine Präferenz für die Stimme der Mutter hat. Die Messung der Saugfrequenz eignet sich vor allem für Experimente nach dem Habituationsparadigma. Hier wird dem Baby ein Seh- oder Hörreiz dargeboten. Wenn der Reiz zum ersten Mal präsentiert wird, steigt normalerweise die Saugfrequenz, um nach einer Weile wieder zu sinken. Das Baby hat sich an den Reiz gewöhnt und nuckelt wieder still vor sich hin. Dann wird der Reiz in einem Merkmal verändert und dem Baby noch einmal dargeboten. Wenn die Saugfrequenz des Babys nun wieder merklich steigt, hat es die Merkmalsveränderung wahrgenommen. Man kann z. B. dem Baby den Konsonanten [l] mehrmals vorspielen und ihn anschließend langsam akustisch zu einem [r] transformieren. Steigt seine Saugfrequenz ab einem bestimmten Punkt, kann man annehmen, dass es die beiden Konsonanten unterscheidet. Experimente nach dem Überraschungsparadigma zeigen, wie bereits kleine Kinder Reize anhand von Vorerwartungen und Schemata verarbeiten. So reagieren Babys überrascht, wenn in einer Filmsequenz mit der Mutter plötzlich aus deren Mund eine fremde Stimme ertönt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bilingualer Erstspracherwerb»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bilingualer Erstspracherwerb» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bilingualer Erstspracherwerb» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.