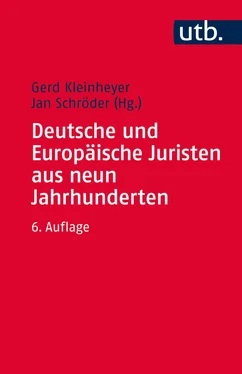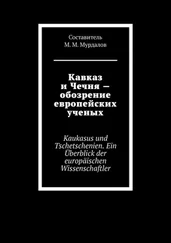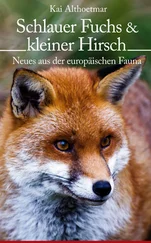Weitgehend unter dem Einfluß der historischen Schule standen auch die nun verstärkt einsetzenden Bemühungen um die partikularen Privatrechte. Am meisten gilt das für Wächters Bearbeitung des württembergischen Privatrechts (anders die Arbeit Reyschers ), mit gewissen Einschränkungen auch für Falcks Darstellung des schleswig-holsteinischen und die des preußischen Privatrechts durch Bornemann , Koch und Dernburg . Am wenigsten von der historischen Schule beeinflußt blieb verständlicherweise das rheinische Recht (code civil, K.S. Zachariä , → Daniels Daniels, Heinrich Gottfried Wilhelm (1754–1827)).
Auch in Österreich und der Schweiz wurde die historische Schule bedeutsam. → Bluntschli Bluntschli, Johann Caspar (1808–1881), der Schöpfer des Zürcher Privatrechtsgesetzbuches von 1853–55, auf das noch → Eugen Hubers Huber, Zacharias (1669–1732); niederl. Jurist schweizerisches Zivilgesetzbuch von 1907 zum Teil zurückgriff, war ein Schüler → Savignys Savigny, Friedrich Carl v. (1779–1861). Für Österreich hat man geradezu eine „Rezeption“ der |8|deutschen Pandektenwissenschaft durch → Unger Unger, Josef (1828–1913) gesehen, der das ABGB (→ Zeiller Zeiller, Franz v. (1751–1828)) von 1811 „romanisierte“. Einflüsse der historischen Rechtsschule zeigen sich aber auch etwa in Dänemark (→ Ørsted Ørsted, Anders Sandøe (1778–1860)) und Schweden (→ Schlyter Schlyter, Carl Johan (1795–1888)). Generell stellte in der europäischen Rechtswissenschaft des frühen 19. Jahrhunderts die historisch-systematische Richtung das „wissenschaftliche“ Gegengewicht zu den „exegetischen“ Schulen dar, die sich nach den Kodifikationen vor allem in Österreich und Frankreich gebildet hatten.
Schließlich waren auch den großen Darstellungen des Handelsrechts (Thöl, Levin Goldschmidt) , durch die dieses Fachgebiet neben dem allgemeinen Zivilrecht selbständigen wissenschaftlichen Rang erhielt, die Prinzipien der historischen Schule zugrunde gelegt.
Gleichwohl läßt sich von einer völligen Herrschaft der historischen Schule im deutschen Sprachraum keineswegs sprechen. Auch abgesehen von den abtrünnigen Germanisten der vierziger Jahre gab es von Anfang an unterschiedliche, z.T. mehr praktisch (→ Thibaut Thibaut, Anton Friedrich Justus (1772–1840)), z.T. mehr philosophisch (die Hegelschule, vor allem Gans ) akzentuierte Gegenströmungen.
Im Strafrecht ließ das an der Wende zum 19. Jahrhundert besonders heftig diskutierte Problem der philosophischen Grundlagen die Wendung zu einer historischen Betrachtungsweise nicht ohne weiteres zu. Immerhin hatte → Feuerbach Feuerbach, Paul Johann Anselm (1775–1833), der Schöpfer der aufklärerisch-liberalen „psychologischen Zwangstheorie“, in seiner zweiten Periode (etwa ab 1810) sehr starke empirische Interessen. Ganz in den Vordergrund traten diese bei seinem Schüler → Mittermaier Mittermaier, Karl Josef Anton (1787–1867). Gleichzeitig entwickelten sich jedoch, sehr viel stärker als im weniger ideologieanfälligen Zivilrecht, hegelianische Vorstellungen (Köstlin, Berner) . Durch sie wurde gegenüber der → Feuerbach Feuerbach, Paul Johann Anselm (1775–1833)schen Generalpräventionstheorie die Vergeltungstheorie wieder herrschend; das Interesse an Aufklärung der tatsächlichen Voraussetzungen des Verbrechens und des Strafvollzugs trat zurück. Die Vergeltungstheorie wurde schließlich auch noch festgehalten, als ihre philosophische Begründung verblaßt und die Strafrechtslehre in eine rein positivistische Behandlung des StGB von 1871 eingeschwenkt war (→ Binding Binding, Karl (1841–1920)).
Die Staatsrechtswissenschaft stand nach dem Ende des alten Reichs und der Durchsetzung konstitutioneller Ordnungen in den Einzelstaaten vor einer völlig veränderten Aufgabe. Unter den Bearbeitungen der Partikularstaatsrechte ragt → Mohls Mohl, Robert v. (1799–1875) gemäßigt liberales württembergisches Staatsrecht hervor. Es war noch unbeeinflußt vom Formalismus der historischen Schule, der, wesentlich später als im Zivilrecht, |9|(ver mittelt durch Gerber ) auch für die Darstellung des Reichsstaatsrechts durch → Laband Laband, Paul (1838–1918) maßgeblich wurde und zu einer scharfen Trennung von Politik und Staatsrecht führte.
Ähnlich ist die Entwicklung in der erst im 19. Jahrhundert ausgebildeten Verwaltungsrechts wissenschaft. Auch hier stellte → Mohl Mohl, Robert v. (1799–1875) mit seiner „Polizeiwissenschaft“ (die ältere, von einem umfassenderen Polizeibegriff als die Gegenwart ausgehende, Bezeichnung) einen Anfang dar, der auch rechtspolitisch, durch seine Ansätze zu der dann von → Gneist Gneist, Rudolf v. (1816–1895) durchgesetzten Forderung nach einer selbständigen Verwaltungsgerichtsbarkeit, von Bedeutung war. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich dann auch hier endgültig die juristisch-formalistische Betrachtungsweise mit dem „Klassiker“ → Otto Mayer Otto (1815–1867); bayer. Prinz, König v. Griechenland durch, der gegenüber die mehr soziologische Erfassung der Verwaltung (im 19. Jahrhundert repräsentativ vor allem → L. v. Stein Stein, Lorenz v. (1815–1890)) zurücktrat. Erst die moderne „Verwaltungslehre“, deren Wurzeln bis zu → Seckendorff Seckendorff, Veit Ludwig v. (1626–1692) zurückreichen, hat diese wieder belebt.
Auch das Kirchenrecht verdankt der historischen Schule eine wissenschaftliche Neubelebung. Zwei der bedeutendsten Anhänger der Schule (→ Eichhorn Eichhorn, Karl Friedrich (1781–1854), → Puchta Puchta, Wolfgang Heinrich (1769–1845); Justizamtmann, später Landrichter) verfaßten umfangreiche Darstellungen, und auch das erfolgreiche Werk Richters ist nach den Schulengrundsätzen gearbeitet. Das unvollendete „System“ → Hinschius Hinschius, Paul (1835–1898)’ gehört gleichfalls noch in diesen Zusammenhang. Schwerer einzuordnen ist der grundlegende Neuansatz → Sohms Sohm, Rudolf (1841–1917) am Jahrhundertende.
2. Soziologischer und strikter Rechtspositivismus
Schon in der ersten Jahrhunderthälfte hatte die Übernahme naturwissenschaftlicher Vorstellungen, vor allem des Kausalitätsprinzips, zu den Anfängen einer selbständigen Gesellschaftswissenschaft (Comte, John Stuart Mill, Spencer) geführt. Deren Vorstellungen waren dann etwa von der Jahrhundertmitte an auch in andere „Geisteswissenschaften“, etwa in die Literaturwissenschaft (Scherer) , eingedrungen. In der Jurisprudenz wurden sie in sehr unterschiedlicher Weise und Intensität aufgenommen. Allgemein läßt sich sagen, daß an die Stelle des Idealismus der historischen Schule und der Erklärung der Rechtssätze aus dem vernünftigen inneren System des Rechts eine empirisch-positivistische Rechtswissenschaft treten sollte. Diese konnte dann als soziologischer Positivismus und kausale Erklärung der Rechtssätze aus ihren gesellschaftlichen Grundlagen (bzw. als unmittelbarer Rückgriff auf diese als Rechtsquelle) auftreten, aber auch – wie später in |10|→ Kelsens „Reiner Rechtslehre“ – als von allen sozialen und idealen Elementen gereinigter strikter Rechtspositivismus. Ganz herrschend war zunächst die soziologische Variante, die auch neue Wissenschaftszweige wie Rechtssoziologie und Kriminologie hervorgebracht hat.
Im Privatrecht hat man schon immer in der Wendung → Jherings Jhering, Rudolf von (1818–1892) von der „Begriffs-“ zur Zweckjurisprudenz den Beginn der neuen Richtung gesehen. Neben ihr, aber ihr verwandt, entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in vielen europäischen Ländern eine soziologische Bewegung, deren bedeutendster Vertreter wohl der Franzose → Gény Gény, François (1861–1959) war. In Deutschland blieb unter dem unglücklich gewählten Namen „Freirechtsschule“ das wirkliche Anliegen eher verborgen (→ Kantorowicz Kantorowicz, Hermann (1877–1940), → Ehrlich Ehrlich, Eugen (1862–1922), → Fuchs Fuchs, Ernst (1859–1929)). Es bestand darin, Lücken des gesetzten Rechts (die als sehr häufig dargestellt wurden) durch Rückgriff auf die gesellschaftlichen Rechtsvorstellungen zu schließen. Die in dieser Forderung vorausgesetzte Identität von Recht und gesellschaftlicher Ordnung war auch die Grundlage für → Ehrlichs Ehrlich, Eugen (1862–1922) Rechtssoziologie; sie trieb neue Wissenschaften wie die privatrechtliche Rechtstatsachenforschung (Nußbaum) hervor. Im Zivilrecht drangen diese Ansätze jedoch nur in gemäßigter Form durch, einerseits als „Interessenjurisprudenz“ (→ Heck Heck, Philipp (1858–1943), der unmittelbar an → Jhering Jhering, Rudolf von (1818–1892) anknüpfte), andererseits als weniger scharf ausgeprägte „Zweckjurisprudenz“.
Читать дальше