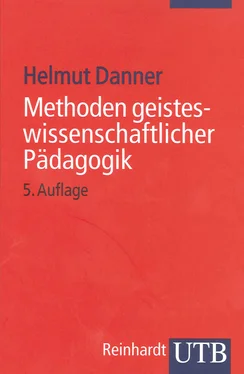Wenn es nicht gleichgültig sein soll, welche Forschungsmethode angewandt wird, so ist damit noch etwas anderes gesagt: Jedes methodische Vorgehen hat seine ganz bestimmte Möglichkeit und seine Grenzen (Röhrs 1971, 42). Man kann also von einer Methode nur etwas Bestimmtes erwarten; anderes leistet sie dagegen nicht. Auf unser Beispiel mit den autoritären Vätern bezogen, bedeutet das: Wenn ich die Verbote, welche sie erteilen, lediglich zähle, dann kann ich über die Häufigkeit autoritären Verhaltens Aufschluss erhalten; das Zählen bringt mich jedoch nicht weiter bei der Frage nach dem, was „autoritär“ überhaupt ist und bedeutet; das Zählen sagt nichts aus über den Sinn, die Berechtigung von Erziehungsverboten, auch nicht über die Auswirkung auf das Kind, auf sein Verhältnis zum Vater usw.
All dies leistet schon eher die verstehende Methode, die versucht, etwa die Verbote innerhalb des Gesamtrahmens der Erziehung zu sehen, 17sie einzuordnen und gesamtmenschlich zu beurteilen; sie kann zu einer Differenzierung kommen und zwischen berechtigten und unsinnigen Verboten, zwischen autoritativem und autoritärem Erziehungsverhalten unterscheiden. Der Unterschied besteht u. a. darin, dass der autoritäre Erzieher seine Überlegenheit so ausnutzt und ausspielt, dass sich das Kind nicht entfalten kann, während der autoritative seine Überlegenheit positiv einsetzt, um dem Kind gerade zur Selbstentfaltung zu verhelfen. Durch Verstehen und Deuten komme ich zu keiner Aussage darüber, wie verbreitet autoritäres Verhalten innerhalb einer Gesellschaft ist.
Nun sind aber Forschungsmethoden im pädagogischen Zusammenhang nicht einfach jeweils verschiedene Instrumente, die man nach Gutdünken einsetzen kann. Sie unterscheiden sich nicht nur formal, sondern auch inhaltlich. Die Häufigkeit eines erzieherischen Verhaltens abzuzählen oder dieses verstehen zu wollen, sind zwei grundverschiedene Dinge; der Erziehungswissenschaftler kann seinen Untersuchungsgegenstand unter Umständen total verfehlen, ihn gar nicht in den Blick bekommen, wenn er nicht die angemessene Methode anwendet. Was als „angemessen“ zu gelten hat, daran scheiden sich die Geister. Es ist, wie wir schon angedeutet haben, im Letzten eine Frage des Menschen- und auch des Weltbildes. 4
Die Methodenfrage würde jedoch zu einseitig gesehen werden, wenn man meinte, man müsse sich für eine einzige Methode entscheiden. Wissenschaftliche Forschung geschieht immer durch das Zusammenwirken mehrerer Methoden. Der wissenschaftstheoretische oder weltanschauliche Streit um die „richtigen“ Methoden spielt sich darum auch zwischen Gruppen von Methoden ab, im Wesentlichen zwischen den geisteswissenschaftlichen und den empirisch-analytischen. Unter geisteswissenschaftlichen Methoden werden ziemlich übereinstimmend folgende verstanden: Hermeneutik (als verstehende und historische Methode), Phänomenologie und Dialektik. 5Für die empirischen Methoden ist eine Aufzählung nicht so eindeutig; am häufigsten werden dazu aufgeführt: Beobachtung, Befragung, Experiment, Test und Statistik. 6Aber auch jene Polarisierung zwischen empirischen und geisteswissenschaftlichen Methoden müsste nicht so extrem und ausschließlich sein, wenn diese jeweils sinnvoll eingesetzt und ergänzend aufeinander bezogen würden. 7
Diese skizzenhaften Andeutungen sollen zeigen: Das Kennenlernen von und das Nachdenken über Methoden sollen zu einem kritischen Bewusstsein verhelfen, was eine Methode leisten kann und was nicht. Es soll dadurch auch bewusst werden, was man unter Umständen versäumt, 18wenn man eine Methode nicht anwendet. Dieses Methodenbewusstsein vermag den Sinn für Wissenschaftlichkeit zu wecken; denn wissenschaftliches Arbeiten ist methodisches Arbeiten. Darum erweist es sich auch für den Studierenden als sinnvoll, Forschungsmethoden kennen zu lernen und mit der Zeit auch selbstständig und bewusst anzuwenden.
Wenn wir uns hier ausführlich mit ‚geisteswissenschaftlichen‘ – oder allgemeiner: sinn-orientierten – Forschungsmethoden befassen wollen, so soll dennoch von Anfang an die Methodenfrage auch in ihrer begrenzten und relativen Bedeutung gesehen werden. Der Satz „wissenschaftliches Arbeiten ist methodisches Arbeiten“ lässt sich nämlich nicht umkehren. Nicht jedes methodische Vorgehen garantiert schon Wissenschaftlichkeit. Wenn wir also Pädagogik als Wissenschaft ernst nehmen wollen, dann dürfen wir nicht die Methodenfrage zum obersten und einzigen Prinzip erheben; die Methode übernimmt „bei der Beantwortung eines Fragezusammenhanges nur eine dienende Funktion“ (Linke 1966, 157). Wir müssen uns also vor einer Methodengläubigkeit hüten (Feyerabend 1976; Wuchterl 1977, 57 f). Denn mit statistischen Erhebungen über Schülerverhalten oder mit phänomenologischem Beschreiben der Mutter-Kind-Beziehung allein ist pädagogisch noch nichts oder nur wenig ausgesagt.
Zudem kann wohl nicht geleugnet werden, dass die Methodendiskussion in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer gewissen Mode-Erscheinung geworden war. „Vielleicht ist es keine Übertreibung zu behaupten, daß sie [die Methodologie] selten so eifrig gepflegt wurde wie in unserer Zeit“ (Bocheński 1969, 138). In Deutschland hatte das den geschichtlichen Hintergrund, dass in den sechziger Jahren damit begonnen worden war, die empirisch-analytischen und sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnisse und -methoden zu übernehmen, die in der übrigen westlichen Welt erzielt bzw. angewandt wurden. 8
Mehr oder weniger dazu gedrängt, kam damit auch die geisteswissenschaftliche Pädagogik in die Situation, verstärkt Methodenreflexion zu betreiben. Dies hatte die positive Auswirkung, dass sie sich wissenschaftstheoretisch darstellen und dadurch selbst kritisch prüfen musste. Gleichzeitig geriet sie in Gefahr, ihre inhaltliche Aufgabe zu vernachlässigen, nur weil sie einem modischen Trend nachgab (Wuchterl 1977, 5). In einer ähnlichen Lage der wissenschaftstheoretischen Begründung der Geisteswissenschaften im Fahrwasser der Naturwissenschaften befand sich W. Dilthey vor rund 120 Jahren. Dabei aber „hat sich Dilthey von dem Vorbild der Naturwissenschaften zutiefst bestimmen lassen, auch wenn er gerade die methodische Selbständigkeit 19der Geisteswissenschaften rechtfertigen wollte“ (Gadamer 1975, 4). Könnte dieser modische Trend, geistesgeschichtlich gesehen, nicht darin bestehen, dass man die Flucht ins Formale angetreten hat, weil man unfähig geworden ist, inhaltlich etwas auszusagen? Auch aus diesem Grund also sollte die Methodenfrage nicht überbewertet, wenn auch in ihrer sinnvollen Aufgabe nicht unterschätzt werden (Nicklis/Wehrmeyer 1976, 6 f).
Ein Gesichtspunkt soll noch genannt werden, der sich aus einer Überbetonung des Methodenproblems ergibt: die Verdeckung des Gegenstandes durch die Methoden. Was damit gemeint ist, haben wir in unseren Beispielen schon angedeutet. Wenn ich z. B. zu einer Aussage darüber kommen will, welche Bedeutung das Vertrauen in der Erziehung hat, werde ich mir etwa durch empirisch-analytische Methoden den Weg verbauen (Bollnow 1969b, 26f). Das Phänomen des zwischenmenschlichen Vertrauens entzieht sich des quantitativen Zugriffs; es schlüpft durch das Gitterwerk einer Statistik; durch experimentelles Vorgehen wird es von vornherein verhindert. Gehe ich also mit bestimmten Methoden, in diesem Fall mit empirischen, ohne auf die Art des Gegenstandes zu achten, an diesen heran, so kann sich dieser entziehen; in unserem Beispiel müsste ich zu dem Ergebnis kommen, dass es pädagogisches Vertrauen überhaupt nicht gibt. „Es gibt … im Lernprozess … Mechanismen. Die Methode der experimentellen pädagogischen Psychologie versuchte sie zu erfassen. Sie entschied, wie man am leichtesten, gründlichsten, z. B. memoriert; aber ob man so lernen soll und was und in welchem Maße, darüber konnte sie keine Aussagen machen“ (Flitner 1989, 370). Der Gegenstand also muss die Methode bestimmen, nicht umgekehrt; die wissenschaftliche – und pädagogische – Fragestellung muss der Ausgang sein, nicht die Methode. 9
Читать дальше