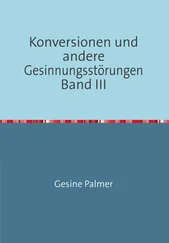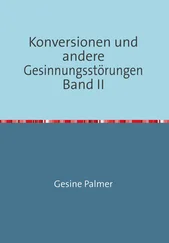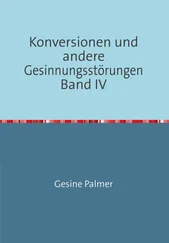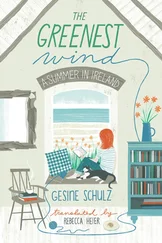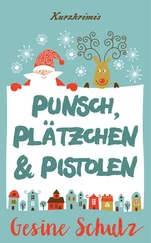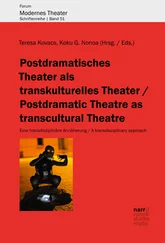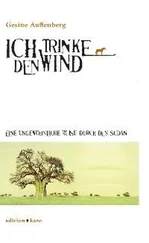Ein weiteres wichtiges Element der Ausstattung von Schauspielern fast aller dramatischen Gattungen waren Masken. Allerdings ist die Frage, ob römische Schauspieler der Hauptdramengattungen in der republikanischen Periode Masken trugen oder wann Masken in Rom eingeführt wurden, schwierig zu beantworten und wird kontrovers diskutiert, weil die Informationen in den Quellen nicht eindeutig sind (Cic. de orat. 3,221; Diom. ars 3, GL I, p. 489,11–13; Don. com . 6,3; zu Ter. Eun. , praef. 1,6; Ad. , praef. 1,6; Fest., p. 238,12–20 L.).
 Abb. 12
Abb. 12
Abbildung von Theatermasken
Römisches Öllämpchen (ca. 90–130 n. Chr.), hergestellt von L. Fabricius Masculus (Firmenstempel) in Italien; auf dem Spiegel der Lampe drei Sklavenmasken (London, British Museum, Inv.-Nr. 1958,0215.7)
Derartige Gegenstände zeigen die Beliebtheit des Theaters im kaiserzeitlichen Italien, als Theatermotive weithin zu dekorativen Zwecken verwendet wurden.
Insgesamt ist der Einsatz von Masken im römischen Theater von einem relativ frühen Zeitpunkt an wahrscheinlich. In allen Gebieten, deren Theaterkultur die Römer vor der Einführung des literarischen Dramas in Rom erlebten, verwendeten die Schauspieler Masken, und diese hatten sich zu einem berufsspezifischen Merkmal von Schauspielern und dramaturgisch vorteilhaften Bestandteilen von Aufführungen entwickelt. Daher wäre es verwunderlich, wenn die Römer dieses Instrument der Inszenierung ignoriert hätten, während sie alle anderen zentralen Bestandteile der Theaterpraxis übernahmen. Dass das lateinische Wort für Maske ( persona ) über das Etruskische ins Lateinische gekommen ist, legt nahe, dass die Sache mit dem Wort übernommen wurde. Atellanen scheinen von Anfang an Masken gehabt zu haben, die die darin auftretenden typischen Figuren erkennbar machen, während es im Mimus keine Masken gab.
Autoren der Kaiserzeit gehen von Aufführungen mit Masken aus: Quintilian beispielsweise bietet nicht nur eine Liste von Standardcharakteren auf der Bühne und ihrer verschiedenen emotionalen Disposition, sondern erwähnt auch eine zweigeteilte Maske des pater familias , die dem Schauspieler ermöglicht, dem Publikum jeweils die Seite zu zeigen, die die gegenwärtige Gefühlslage repräsentiert (Quint. inst. 11,3,73–74 [▶ T 5]).
T 5 Quintilian, inst. 11,3,73–74
| itaque in iis quae ad scaenam componuntur fabulis artifices pronuntiandi a personis quoque adfectus mutuantur, ut sit Aerope in tragoedia tristis, atrox Medea, attonitus Aiax, truculentus Hercules. [74] in comoediis vero praeter aliam observationem, qua servi lenones parasiti rustici milites meretriculae ancillae, senes austeri ac mites, iuvenes severi ac luxuriosi, matronae puellae inter se discernuntur, pater ille, cuius praecipuae partes sunt, quia interim concitatus interim lenis est, altero erecto altero composito est supercilio, atque id ostendere maxime latus actoribus moris est quod cum iis quas agunt partibus congruat. |
Deshalb borgen sich in Stücken, die für die Bühne verfasst sind, die Vortragskünstler zusätzlich von den Masken Emotionen, sodass, in der Tragödie, Aerope traurig ist, Medea wild, Aiax von Sinnen, Hercules polterig. [74] In Komödien jedoch hat neben anderen wahrnehmbaren Zeichen, wodurch Sklaven, Kuppler, Parasiten, Bauern, Soldaten, Hetären, Mägde, strenge und milde alte Männer, ernsthafte und verschwenderische junge Männer, Matronen und junge Mädchen voneinander unterschieden werden, jener Vater, dessen Rolle sich vor anderen auszeichnet, weil er manchmal erregt, manchmal sanft ist, auf der einen Seite eine hochgezogene, auf der anderen eine entspannte Augenbraue, und es ist bei den Schauspielern üblich, diese Seite vor allem zu zeigen, die mit der Rolle, die sie spielen, übereinstimmt. |
Im Laufe der Zeit kam es zu einer immer größeren Ausdifferenzierung der Masken, die für individuelle Standardcharaktere zur Verfügung standen. Bei Pollux findet sich später eine lange Liste tragischer und komischer Masken (Poll. 4,133–142; 4,142–154).
Cicero behauptet, dass ihm oft die Augen eines Schauspielers durch die Maske zu glühen schienen bei einer Äußerung voller starker Emotionen, die der Schauspieler offenbar spürte (Cic. de orat. 2,193). An anderer Stelle bemerkt er, dass die Augen das wichtigste Element des Gesichts seien und daher die ältere Generation, die die dramatische Karriere des Schauspielers Roscius voll miterlebt hatte, in der Regel nicht einmal Roscius besonders lobte, wenn er eine Maske getragen habe, weil man, so muss man schließen, seine Augen nicht sah (Cic. de orat. 3,221). Dennoch geht Cicero davon aus, dass die Beherrschung des Gesichtsausdrucks, der Stimme und der Bewegung signifikante Komponenten der dramatischen Kunst seien, die für gelungene Schauspielkunst optimal aufeinander abgestimmt sein müssen (Cic. de orat. 1,18). Offenbar war es für die Zuschauer möglich, trotz der gleichbleibenden Masken für bestimmte Rollen die Qualität eines Schauspielers am Zusammenspiel von Stimme, Gestik und zu vermutendem Gesichtsausdruck zu erkennen.
Die republikanischen Dichter, die Latein als Literatursprache etablierten und das Abfassen literarischer Werke auf Latein initiierten, stammten nicht aus Rom, sondern aus anderen Teilen Italiens oder sogar anderen Ländern: Livius Andronicus war wahrscheinlich griechischer Herkunft und kam aus Süditalien (Suet. gramm. 1,2). Naevius war ein Kampanier, vielleicht aus Capua (Gell. 1,24,2 [▶ T 32]). Ennius stammte aus der kalabrischen/messapischen Stadt Rudiae (Cic. Arch. 22; Enn. inc. 10 W. = ann. 525 Sk.; Hor. carm. 4,8,20; Serv. zu Verg. Aen. 7,691). Sein Neffe Pacuvius war oskischer Herkunft und wurde in Brundisium (Brindisi) geboren (Hier. chron. 1863, zu 154 v. Chr. [p. 142e Helm]). Plautus kam aus dem umbrischen Sarsina (Fest., p. 274 L. = Paul. Fest., p. 275,1–3 L.; Hier. chron. 1817, zu 200 v. Chr. [p. 135h Helm]; Suet. vita Plaut. ). Caecilius Statius war ein Insubrer aus Gallien (Hier. chron. 1838, zu 179 v. Chr. [p. 138b Helm]; Suet. vita Caec. ). Terenz war afrikanischer Herkunft (Suet./Don. vita Ter. 1). Publilius Syrus stammte aus Syrien (Macr. Sat. 2,7,6; Hier. chron. 1974, zu 43 v. Chr. [p. 157k Helm]). Die drei Letzten waren Sklaven und wurden später von ihren Herren freigelassen, wie wahrscheinlich auch Livius Andronicus. Accius war der Sohn von Freigelassenen (Hier. chron. 1878, zu 139 v. Chr. [p. 144h Helm]; Suet. vita Acc. ). L. Livius Andronicus und Q. Ennius erhielten später das römische Bürgerrecht (Liv. Andr.: vgl. tria nomina ; Enn.: vgl. Cic. Brut. 79; Arch. 22).
Alle Gegenden im Mittelmeerraum, aus denen diese ‚römischen‘ Dramatiker stammten, vor allem Kampanien und das Gebiet um Tarent, waren von griechischer Kultur beeinflusst. Daher brachten diese Dichter Vertrautheit mit lokalen Bräuchen und Sprachen sowie mit griechischer Tradition nach Rom, wo sie wieder einen anderen kulturellen Kontext fanden. Aufgrund ihrer Herkunft und Ausbildung waren diese Dramatiker an eine kulturelle Vielfaltgewöhnt und in der Lage, Dramen für das römische Publikum zu schaffen. Dadurch, dass sie die lateinische Sprache für ihre in Rom produzierten literarischen Werke verwendeten, trugen die nicht-römischen Dramatiker dazu bei, Roms Sprache und nationale Identität zu formen.
Читать дальше
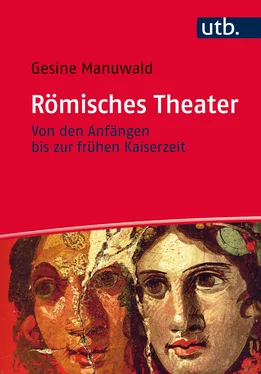
 Abb. 12
Abb. 12