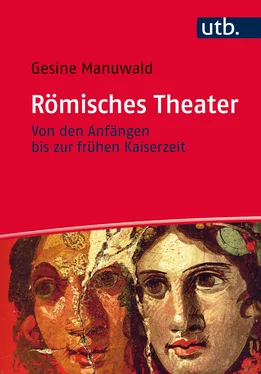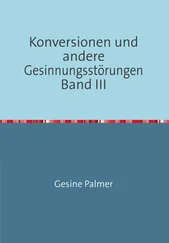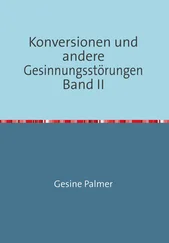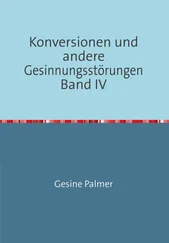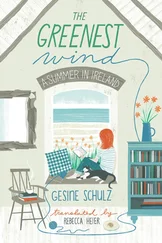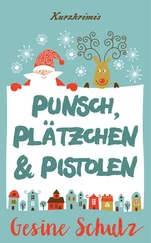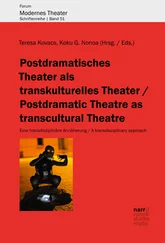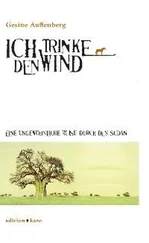In einem römischen Theaterbildete der Zuschauerraum( cavea ) – im Unterschied zu dem über einen Halbkreis hinausgehenden des griechischen Theaters – ungefähr einen Halbkreis, die Bühne war niedrig, hatte eine gewisse Tiefendimension und wurde hinten abgeschlossen durch die mächtige Fassade ( scaenae frons ) des Bühnenhauses. Diese Wand war ursprünglich ungeschmückt und später bemalt und dekoriert (z.B. Plin. nat. 35,23; Val. Max. 2,4,6). Die Fassade hatte normalerweise drei Türen, die in runde oder rechteckige Nischen ( exedrae ) zurückgesetzt sein konnten, wodurch sich kleine Vorräume ( vestibula ) ergaben. Die hervorragenden Flügel des Bühnenhauses schlossen die Bühne auf beiden Seiten ein. Dieses Gebäude war ursprünglich von bescheidener Höhe und hatte ein begehbares flaches Dach (Plaut. Amph. 1008). Später erreichte die Wand dieselbe Höhe wie der Zuschauerraum.
Entsprechend der andersartigen Konzeption des griechischen Theaters war dort die Bühne weiter zurückgenommen, und die Fläche zwischen der Bühne und der ersten Reihe der Sitze (‚Orchestra‘) entsprach in klassischer Zeit eher einem ganzen Kreis, während sie im römischen Theater (in der Kaiserzeit orchestra genannt) eher einen Halbkreis bildete. Sie wurde üblicherweise nicht von den Schauspielern genutzt und diente nicht als Tanzraum für einen Chor (wie in Griechenland), sondern dort waren Sitze (in spätrepublikanischer Zeit) für Honoratioren aufgestellt (z.B. Vitr. 5,6,2; Suet. Claud. 21,1). Logen ( tribunalia ) für die Veranstalter befanden sich über den gewölbten Seiteneingängen (zu beiden Seiten des Zuschauerraums), während diese Seiteneingänge im griechischen Theater offen waren.
Da der Halbkreis des Zuschauerbereichs im römischen Theater durch den breit angelegten Bühnenteil sozusagen abgeschlossen wurde, ermöglichten die Seiteneingängezwischen Bühne und Zuschauerbereich einen direkten Zugang zur Bühne, etwa für große Gruppen von Akteuren. Diese Anordnung kommt der Tendenz des römischen Dramas entgegen, eine größere Zahl von (sekundären) Charakteren auf der Bühne zu haben (Ter. Haut. II 3–4; Cic. fam. 7,1,2 [▶ T 3]; Hor. epist. 2,1,187–207 [▶ T 13]).
3.4. Bühnenpraxis, Kostüme, Masken
Da es lediglich für die republikanische Zeit sicher ist, dass vollständige Dramen im Theater aufgeführt wurden, und es nur aus dieser Periode zeitgenössische oder zeitnahe Quellen dazu gibt, beziehen sich Aussagen über Bühnenpraxis im Wesentlichen auf diese Epoche. Charakteristika des römischen Dramas, die sich in dieser Zeit etablierten, werden jedoch, mit den entsprechenden Veränderungen im Hinblick auf die sich entwickelnden Theaterbauten (▶ Kap. 3.3), fortbestanden haben, sofern Dramen weiterhin auf der Bühne aufgeführt wurden.
Da dieselbe Bühne ohne spezifische Kulissenfür Aufführungen von ernsten wie von leichten Dramen genutzt wurde (mit gewissen Modifikationen im Laufe der Zeit), konnten für den Handlungsablauf relevante visuelle Details nur durch die Äußerungen und die Gesten von Figuren, das Geschehen auf der Bühne oder die Verwendung von (beweglichen) Requisiten verdeutlicht werden. Erst für 99 v. Chr. ist die Einführung bemalter Szenerie belegt (Val. Max. 2,4,6), und der augusteische Schriftsteller Vitruv spricht dann von drehbaren Vorrichtungen, die drei Seiten mit verschiedenen Arten von Szenerie haben, die entsprechend der jeweiligen Gattung des Dramas ausgerichtet werden können (Vitr. 5,6,8–9). Die erhaltenen Texte römischer Dramen enthalten keine separaten Regieanweisungen; einige indirekte können jedoch den Äußerungen der Figuren entnommen werden, wenn sie beispielsweise die Szenerie beschreiben oder das Herankommen weiterer Personen ankündigen.
Die Dramatiker waren sich offensichtlich bewusst, dass die in unterschiedlichen Dramen gleichbleibende Bühnengestaltunges erforderlich machte, die jeweilige Funktion der Kulisse zu erläutern, damit die Zuschauer etwa die Türen in der Bühnenrückwand für das konkrete Stück identifizieren konnten (Plaut. Men. 72–76; Rud. 32–33; Truc. 1–3; 10–11). Wenn die Bühne im Prolog als ein bestimmter Ort identifiziert wird, erhöhen sich dadurch der fiktionale Aspekt der Aufführung und zugleich die Anforderungen an die Vorstellungskraft der Zuschauer.
Die Identifikation konnte durch die Nennung eines Ortsnamens (z.B. Plaut. Mil. 88; Truc. 1–3; 10–11) und/oder der Funktion der Gebäude bzw. deren Bewohner (z.B. Plaut. Rud. 33–35; 61; Truc. 12; 77; 246) erfolgen. Denn die Türen in der Bühnenrückwand repräsentierten Gebäude (z.B. Plaut. Cas. 35–36; Rud. 33–35; 61), die private Häuser, bewohnt von Bürgern, aber auch von Kupplern oder Hetären, sowie königliche Paläste, Tempel oder eine Kombination verschiedener Typen von Gebäuden darstellten.
Einen Bühnenvorhanggab es ursprünglich nicht. Der Beginn eines Stücks wurde von einem Prologsprecher und gelegentlich einem Herold ( praeco ) angekündigt; das Ende war markiert, indem einer oder alle Charaktere um Applaus baten (Hor. ars 154–155; Porph. ad loc. ; Quint. inst. 6,1,52). Die Einführung eines Vorhangs ( aulaeum ) ungefähr 133 v. Chr. (Don. com. 8,8; Serv. zu Verg. Aen. 1,697) ermöglichte dann, den Anfang und das Ende von Dramen zu kennzeichnen, in klassischer Zeit durch Senken des Vorhangs zu Beginn (in eine Rinne am Rand der Bühne) und durch Hochziehen am Ende der Aufführung (Cic. Cael. 65; Verg. georg. 3,25; Hor. epist. 2,1,189 [▶ T 13]; ars 154).
Auf beiden Seiten der Bühne gab es jeweils einen Seiteneingang: Der auf der rechten Seite von den Zuschauern aus gesehen wird üblicherweise als derjenige betrachtet, der in die Nähe führt, also zum Forum und Stadtzentrum bei den meist in einer Stadt spielenden Komödien, der auf der linken Seite in die Ferne, also zum Hafen oder auf das Land (Vitr. 5,6,8).
Dass die Bühne einen offenen Platzrepräsentiert, bedeutet, dass alle auf der Bühne vorgeführten Aktionen als in der Öffentlichkeit stattfindendes Geschehen vorzustellen sind. Daher kann das Publikum direkt lediglich miterleben, was draußen passiert. Charaktere kommen deswegen aus dem Haus, wenn die Handlung weitergehen soll (z.B. Ter. Eun. 668) oder wichtige Informationen vermittelt werden müssen, wofür im Ablauf der Handlung der Eindruck eines zufälligen zeitlichen Zusammentreffens erweckt wird.
Ereignisse, die aus verschiedenen Gründen nicht auf der Bühne gezeigt werden können, werden durch sogenannte Botenberichtevermittelt, also durch Berichte von Figuren, die Vorgänge, die in einem der Innenräume oder an einem anderen Ort geschehen sind, gesehen haben. Eine Verbindung zwischen Draußen und Drinnen besteht, wenn Figuren die Bühne betreten und dabei eine Rede an Leute im Haus beenden oder wenn sie berichten, was sie im Haus sehen.
Die Klarheit der Bewegungsabläufe innerhalb der Handlung wurde dadurch verstärkt, dass die Figuren normalerweise durch denselben Ein- und Ausgang wieder auftreten, durch den sie die Bühne verlassen haben, und oft erläutern, was sie inzwischen getan haben oder nun vorhaben. Wenn die Rückkehr einer Person durch denselben Eingang aus dramatischen Gründen nicht passend war, konnten die Dramatiker sich der Vorstellung eines angiportum / angiportus bedienen, eines rückwärtigen Gässchens, durch das die Figuren durch einen Hinterausgang der Häuser, deren Vorderseite die Bühnenrückwand bildet, in ein anderes Haus oder in die Stadt, zum Hafen oder auf das Land gelangen konnten. In solchen Fällen werden die Bewegungsabläufe, die sich aus der Bühnenhandlung nicht klar ergeben, in der Regel kommentiert (z.B. Plaut. Most. 931; 1043–1046; Ter. Eun. 840–847). Wenn Figuren die Bühne betreten, können sie von anderen eingeführt werden oder sich selbst vorstellen und charakterisieren; wenn Figuren die Bühne verlassen, kündigen sie das meist vorher an.
Читать дальше