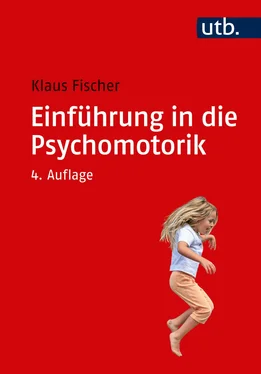Klaus Fischer - Einführung in die Psychomotorik
Здесь есть возможность читать онлайн «Klaus Fischer - Einführung in die Psychomotorik» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Einführung in die Psychomotorik
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Einführung in die Psychomotorik: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einführung in die Psychomotorik»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die 4. Auflage ist grundlegend überarbeitet, neu sind bspw. die Themen Kinderspiel, Embodiment und Wirksamkeitsforschung.
Einführung in die Psychomotorik — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einführung in die Psychomotorik», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:

Die klassische Theorielegung der Motologie ist ein Beitrag zur Verwissenschaftlichung der Psychomotorik, dennoch ein Kind ihrer Zeit und gerät aus diesem Grund mit dem sich wandelnden Wissenschaftsverständnis der 1990er-Jahre in die Kritik. Diese bezieht sich im Wesentlichen auf die ursprünglich linear-kausale Modellvorstellung der Psychomotorik (Motologie) und den nur schleppenden Übergang zu einem ressourcenorientiert-kontextuellen Wissenschaftsverständnis des Ansatzes.
1.5 Paradigmenwechsel in der Fachdiskussion
Der Mensch als Subjekt
Der Wandel zu einer eher ganzheitlichen Sichtweise in der Wissenschaft beginnt vor mehr als einem halben Jahrhundert und ist noch nicht abgeschlossen. Der Mediziner und Philosoph Viktor von Weizsäcker kann als geistiger Initiator des Paradigmenwechsels in der wissenschaftlichen Diskussion betrachtet werden, da er in den fünfziger Jahren die Aufhebung des Dualismus fordert und der Frage nachgeht, wie sich Subjekt und Objekt, d.h. Mensch und Welt, begegnen (Philippi-Eisenburger 1991a, 10). Er sieht den Menschen als einen aktiven, sich selbst gestaltenden und ganzheitlichen Organismus an, den das informationstheoretische Verarbeitungsmodell nicht hinreichend darstellen kann, da Phänomene von Wahrnehmung und Bewegung nicht berücksichtigt werden.Von Weizsäcker legt damit die theoretische Grundlage für neuere konzeptionelle Entwicklungen in der Psychomotorik (Motologie). In der gegenwärtigen postmodernen Sichtweise wird der Mensch als Subjekt,als ein „sich bewegendes, wahrnehmendes, fühlendes, denkendes und sinngebendes“ (Philippi-Eisenburger 1991a, 10; Eisenburger 2003a)Wesen, damit als Person gesehen und innerhalb eines Netzwerkes von Entwicklungsfaktoren verortet. Über verschiedene Zwischenschritte des Fachdiskurses hat sich das Wissenschaftsverständnis der Psychomotorik und Motologie kontinuierlich weiterentwickelt und ein modernes Menschen- und Weltbild etabliert (Hammer 2004a; Mattner 2004).
Darüber hinaus trifft die Fachdebatte auf einen internationalen und interdisziplinären Fachdiskurs, der Bewegung und Körperlichkeit (Embodiment) zur tragenden Thematik in den Kognitions- und Entwicklungswissenschaften erhebt und ein (radikal) ganzheitliches Wissenschaftsverständnis formuliert (Shepherd 2017)(siehe Kap. 3.2).
In der Begriffswahl hat sich seit einiger Zeit der Terminus Psychomotorik gegenüber dem der Motologie durchgesetzt (Fischer 2001a, 2015a, b; Krus/Jasmund 2015; Reichenbach 2011; Zimmer 2012). Zum einen weil Motologie enger das von Schilling (1976a) konzipierte und von Seewald (2007) modifizierte Fachgebiet und den Studiengang in Marburg repräsentiert, zum anderen weil der Begriff Psychomotorik sich als Leitbegriff des von Kiphard begründeten Fachdiskurses über die Einheit von Bewegen, Wahrnehmen, Erleben, Erfahren und Handeln als Basis von Bildung, Förderung und Therapie versteht. Zudem ist Psychomotorik der international gebräuchliche Fachterminus (s. Kap. 1.6).
Vier Perspektiven
In der Konzeption der Psychomotorik der letzten Jahre gibt es verschiedene Diskussionslinien oder Perspektiven, die prinzipiell gemeinsame Leitmotive erkennen lassen (etwa die Orientierung am Kind bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Prinzipien der Ganzheitlichkeit und der Nähe zur Lebenswelt); dennoch gibt es unterschiedliche begriffliche und inhaltliche Akzentsetzungen. Vier Perspektiven seien an dieser Stelle überblicksartig angesprochen (vgl. Fischer 2015a; Fischer/Krus 2013; Krus 2015a; Kuhlenkamp 2017); einzelne Konzepte werden in Kapitel 4 ausführlicher dargestellt.
Die funktionale Perspektive
Die klassische Perspektive ist eher funktional ausgerichtet; sie umfasst den ursprünglichen Ansatz der Psychomotorischen Übungsbehandlung von Kiphard, das Konzept der Klinischen Psychomotorischen Therapie (Jarosch et al. 1993) sowie, aus der engen Zusammenarbeit mit Inge Flehmig am Institut für Kindesentwicklung in Hamburg, die Sensorische Integrationstherapie von Ayres (1984, 1998) in der Weiterentwicklung von Brand et al. (1985) sowie Kesper und Hottinger (1992, 2015), die Bewegung als Funktionsgeschehen betrachten. Hauptkriterien der funktionalen Perspektive sind: Gewandtheit, Wohlkoordiniertheit,Rhythmus, Sicherheit, Tempo, Kraft, Ausdauer, Tonusregulation. Der Ansatz orientiert sich traditionell stärker an der medizinisch-defizitorientierten Sichtweise, in der die vier Stationen Ursachendiagnostik, Therapieindikation, Durchführung der Therapie und Erfolgskontrolle programmatisch durchgeführt werden. In der Psychomotorischen Übungsbehandlung ist die Gruppentherapie mit ihrer sozialen Wechselwirkung von Anfang an wesentlich für den Erfolg. Sie zielt nicht nur auf die Verbesserung bestimmter Teilfunktionen. Das Kind soll durch die gezielte Sinnes- und Bewegungsschulung in seiner gesamten Persönlichkeit gefördert werden. Neuere Konzeptentwicklungen nehmen Bezug zur Systemtheorie (etwa Brüggebors, 1992), eröffnen eine ganzheitlich-dialogische (Kiesling 1999) oder eine symbolische Perspektive in Bezug auf die französische Psychomotorik (Esser 2011;Lapierre/Aucouturier 2002).
Die erkenntnisstrukturierende Perspektive
Die erkenntnisstrukturierende/kompetenztheoretische Perspektive:Dieser stärker an (kognitiven) Kompetenzen orientierte Ansatz, den u.a. Schilling (1977a) und Zimmer (1981a) vertreten, lässt sich entwicklungstheoretisch auf Piaget (1975) zurückführen und enthält lernpsychologische Regeln. Bewegung wird als Strukturierungsleistung und als wichtiger Teil der Handlungsfähigkeit betrachtet. Um Bewegungsmuster zu generalisieren und sich dadurch der sich stetig verändernden Umwelt anzupassen, muss die Wahrnehmung des Kindes in einem Lernprozess umstrukturiert werden. Nach diesem Ansatz ist die Differenzierung von Wahrnehmungs- und Bewegungsmustern die wichtigste Grundlage der Handlungsfähigkeit. Dementsprechend findet der Ansatz eine starke Anwendung in der frühen Förderung, vor allem in vorschul-, grundschul- und heilpädagogischen Kontexten. Die Frage nach den Kompetenzen wird in den letzten Jahren stärker auf Aspekte des subjektiven Bewegungserlebens und die dahinterstehenden sozial-emotionalen Lebensthemen ausgeweitet. Die Konzepte der kindzentrierten psychomotorischen Entwicklungsförderung nach Zimmer (2012) und der psychomotorischen Entwicklungstherapie nach Krus (2004a) integrieren Erkenntnisse der nichtdirektiven Spieltherapie sowie der Selbstkonzepttheorien. Inhaltlich geht es in dieser Perspektive um die Stärkung eines positiven Selbstkonzeptes durch Selbstwirksamkeitserfahrungen in Problemlösesituationen durch Handeln. Insofern habe ich diesen Zugang in früheren Klassifikationen als identitätsbildende Perspektive bezeichnet (Fischer 2001a, b).
Der Verstehende Ansatz
Eine Besonderheit ist der Verstehende Ansatz von Seewald (2007). Er favorisiert eine phänomenologische Grundlegung und integriert tiefenpsychologische Aspekte. Gegenstand der Methode sind Bewegungs- und Spielsituationen, in denen Lebensthemen bespielt werden können. Es geht um das Ausleben von Erlebnissen, Gefühlen und Bedürfnissen der Kinder. Es werden Geschichten und Spielsituationen inszeniert, um ein dialogisches Verstehen der dahinterstehenden Lebensthemen zu ermöglichen.
Die ökologischsystemische Perspektive
Die ökologisch-systemische Perspektive: Dieser Ansatz zielt auf eine Perspektivenerweiterung, da das Kind nicht länger individuumszentriert, sondern im Zusammenhang mit seiner Umwelt betrachtet wird. Zur Entwicklung braucht das Kind Sozialpartner, vor allem die Eltern, Geschwister und Gleichaltrigen sowie die Zeit und den Raum für gemeinsame Aktivität. Somit wird Bewegung zum sozialen und sozialräumlichen Phänomen, weil ein Verstehen der kindlichen Verhaltensweisen nur im Kontext sinnvoll ist (Fischer 1996b, d). Das neue Interesse des Pädagogen oder Therapeuten richtet sich auf den partnerschaftlichen Dialog in der Fördersituation, um die dominierenden Lebensthemen des Kindes zu verstehen (Seewald 1993) und entwicklungsfördernde Angebote zu machen. Das Interesse richtet sich aber auch auf die Frage, unter welchen Bedingungen (z.B. bei Überforderungen) Probleme sichtbar werden und wie Lebensräume (z. B. Spielräume) und Beziehungen gestaltet sein müssen, um eine Vermittlung zwischen individuellen, sozialen und kulturellen Anforderungen zu ermöglichen (Balgo 1998a, 2004, 2009).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Einführung in die Psychomotorik»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einführung in die Psychomotorik» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Einführung in die Psychomotorik» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.