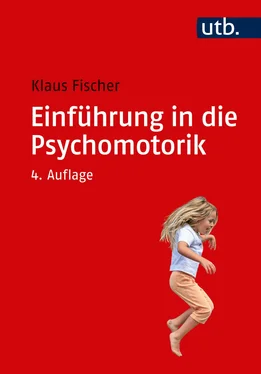Klaus Fischer - Einführung in die Psychomotorik
Здесь есть возможность читать онлайн «Klaus Fischer - Einführung in die Psychomotorik» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Einführung in die Psychomotorik
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Einführung in die Psychomotorik: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einführung in die Psychomotorik»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die 4. Auflage ist grundlegend überarbeitet, neu sind bspw. die Themen Kinderspiel, Embodiment und Wirksamkeitsforschung.
Einführung in die Psychomotorik — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einführung in die Psychomotorik», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
„Wenn Seguin als Voraussetzung für eine gezielte Förderung die Analyse der psychologischen und physiologischen Voraussetzungen der Kinder fordert, so erkennt er bereits den Wert dessen, was später als Diagnostik beschrieben wird“ (Irmischer 1993, 10).
Maria Montessori greift die Ideen der beiden Franzosen auf und integriert sie in ihr differenziertes Erziehungskonzept. Sie stellt die Erziehung der Sinne und der Bewegung in den Vordergrund und entwickelt dazu vielfältige Sinnesmaterialien. So betont sie die Wichtigkeit der Selbsttätigkeit und des Selbstlernens des Kindes, was später von Kiphard aufgegriffen wird. Während jedoch Montessori das Spiel als unnütze Tätigkeit ablehnt, dient es in der Psychomotorik als eine wichtige Ausdrucks- und Tätigkeitsform sowie als therapeutisches Medium (Irmischer 1993, 11). Kiphard entlehnt aus der Montessori-Pädagogik wertvolle Beiträge zur Sinnesschulung und auch einige Ideen über Fördermaterialien.
Geistigorthopädische Übungen
In Auseinandersetzung mit der Arbeit von Maria Montessori entsteht in Deutschland das System der geistig-orthopädischen Übungen von Lesemann (1925, 1972), das die Sonderpädagogik in der Bundesrepublik bis in die fünfziger Jahre beeinflusst. In der reformpädagogischen Tradition stehend weist Lesemann schon sehr früh der motorischen Förderung seiner Hilfsschulkinder einen besonderen Stellenwert zu, um mit einem gezielteren Entgegenwirken körperlicher Beeinträchtigungen und Gebrechen einen Beitrag zur ganzheitlichen Erziehung zu leisten. In der besten Absicht, die kindliche Persönlichkeit als Ganzes zu thematisieren, sind diese Sichtweisen doch ein Beleg für die defektologische Grundlegung der Heilpädagogik der damaligen Zeit und ein Quellennachweis für Parallelen des psychomotorischen Konzepts der Anfangszeit.
Rhythmik
Die Entwicklung der Psychomotorik wird von Anbeginn stark durch die Rhythmik geprägt; Elemente der Rhythmik sind bis heute wichtige Bestandteile psychomotorischer Arbeit. Mimi Scheiblauer (1956) und Charlotte Pfeffer (1958) versuchen, phantasievoll und einfühlsam durch Rhythmik die ganzheitliche natürliche Bewegungsentwicklung ihrer behinderten Kinder zu fördern. Kiphard übernimmt beispielsweise Teile aus dem Orff-Schulwerk und Orff-Instrumente, um das rhythmisch-musikalische Angebot zu erweitern (Schäfer 1993, 21).
Individuelle Zielsetzung
Das Verdienst des Psychologen Löwnau ist es schließlich, die Bewegungserziehung entwicklungsbeeinträchtigter Kinder um gezielte (psycho-)therapeutische Akzente bereichert zu haben. Kennzeichen seiner therapeutischen Überlegungen ist es, stärker individualisierte Zielsetzungen in den Förderprozess zu integrieren. Kein fremdbestimmter Lehr- oder Stoffplan (etwa der Leibeserziehung) solle Problemkindern „übergestülpt“ werden, um durch körperliche Ertüchtigungeine Verhaltensregulation zu erwirken, sondern gehemmte, ängstliche,aber auch unruhige und triebhafte Kinder bräuchten vielmehr einen möglichst behutsamen, nicht direktiven Weg, bei dem die Anerkennung der Persönlichkeit des Kindes im Vordergrund steht (Irmischer 1993, 16). Es sind dies bereits konzeptionelle Strukturelemente, die heute unter dem Begriff kindzentrierte Bewegungserziehung diskutiert werden und die Wesenszüge des psychomotorischen Konzepts ausmachen.
Einflüsse der Leibeserziehung
Wesentliche Impulse erhält die Psychomotorik aus der Leibeserziehung. Vertreter wie Liselott Diem (1935), die bereits 1935 für den Primarbereich eine ganzheitliche Bewegungserziehung fordert, Ludwig Mester, der das Ziel der Leibeserziehung in der Grundschule 1954 in der „Erziehung durch Bewegung“ sieht und Konrad Paschen, der dem Sportunterricht fachübergreifende Erziehungsaufgaben zuweist, sind nur einige Vertreter, die die Entstehung und Entwicklung der Psychomotorik beeinflussen. Von Seiten der Psychomotorik sind diese Quellen und Bezüge nicht hinreichend aufgearbeitet worden; allenfalls Irmischer (1984, 1993) beschäftigt sich mit einer historischen Perspektive. Sie sind jedoch wichtig für die Entstehungsgeschichte und wissenschaftliche Einordnung des Ansatzes sowie die Begründungslinien der aktuellen Annäherung von Psychomotorik und Sportpädagogik im Begriff der Bewegungserziehung. Wichtige Hinweise finden sich bei Röthig (1966) und Größing (1993), die die Quellen der Reformpädagogik und der Gymnastikbewegung – insbesondere des rhythmischen Prinzips – für eine sportpädagogische Grundlegung nachzeichnen. Als Überblicksdarstellung für den Elementar-, Primar- und Förderschulbereich unter einer inklusiven Perspektive ist auch das Werk von Stabe (1996) zur Rhythmik als ganzheitliche Entwicklungsförderung wertvoll. Erst in jüngerer Zeit wird das Thema des Rhythmisch-Musikalischen als wesentliches Element der psychomotorischen Entwicklungsförderung wiedererkannt (Röthig 2002; Wehle 2003; von Dreusche/Graul-Mayr 2006; Bankl 2016).
1.2 Psychomotorik als Meisterlehre
E.J. Kiphard
Der Begriff Psychomotorik ist in Deutschland eng mit dem Namen Kiphard (1923–2010) verbunden; dieser wird nicht selten als „Urvater“und „Seele“ bezeichnet ( Abb. 1). Kiphard entwickelt die wesentlichen Grundzüge der Psychomotorik im Laufe seiner langjährigen Tätigkeit am Westfälischen Institut für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik in Hamm. Kiphard und Hünnekens (als ärztlicher Leiter) verknüpfen im klinischen Kontext die gerade bei dieser besonderen Klientel deutlich zu Tage tretende „diagnostische Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Entwicklungsstörungen/seelischen Behinderungen und motorischen Retardierungen mit dem Ansatz von Therapie über Bewegung, Förderung der Entwicklung über Motorik, der „Psychomotorischen Übungsbehandlung“ (Jarosch et al. 1987, 12). Am Anfang der konzeptionellen Entwicklungen in Deutschland steht in den fünfziger und sechziger Jahren nicht die Theorie, sondern die Praxis.
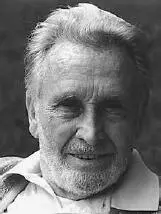
Abb. 1: E. J. Kiphard, der Begründer der deutschen Psychomotorik
Nach dem Umzug der Gütersloher Fachklinik in das Institut für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik nach Hamm (1965) kommt es verstärkt zu Forschungen und Veröffentlichungen über die Bedeutung der Motorik für die kindliche Entwicklung, Möglichkeiten der Motodiagnostik und pädagogischer und therapeutischer Förderung durch Psychomotorik.
Erste Effizienzüberprüfung
Durch einen Forschungsauftrag des Sozialministeriums Nordrhein-Westfalen im Jahre 1957/58 kommt es zu einer ersten Effizienzüberprüfung der damaligen Psychomotorischen Übungsbehandlung.Die Ergebnisse werden 1960 im Jahrbuch der Jugendpsychiatrie (Band 2) veröffentlicht und im gleichen Jahr erscheint die erste Auflage des Büchleins „Bewegung heilt“, in dem Kiphard versucht, die Grundzüge seiner praktischen Arbeit in systematisierter Form darzustellen. Er setzt sich zum Ziel, über die Motorik eine leibseelische Harmonisierung und Stabilisierung der Gesamtpersönlichkeit der ihm anvertrauten jungen Patienten zu bewirken. So werden Übungen zur Sinnesschulung, Körper-, Raumwahrnehmung, Behutsamkeit, Selbstbeherrschung, rhythmisch-musikalischen Schulung und zum Körperausdruck spielerisch motivierend in Kindergruppen durchgeführt.
„Die besondere Faszination, die von der Persönlichkeit Kiphards über Zauberkünste, Gags, akrobatische Einlagen, Einsatz des Schifferklaviers ausging, darf nicht unerwähnt bleiben. Verhaltensänderungen waren bei den Kindern nach einer ca. 6-wöchigen psychomotorischen Übungsbehandlung deutlich beobachtbar: Die Kinder waren aufmerksamer, strukturierter, sozial integrierter, fröhlicher, mutiger und ausgeglichener im Verhalten“ (Schäfer 1998, 82).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Einführung in die Psychomotorik»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einführung in die Psychomotorik» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Einführung in die Psychomotorik» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.