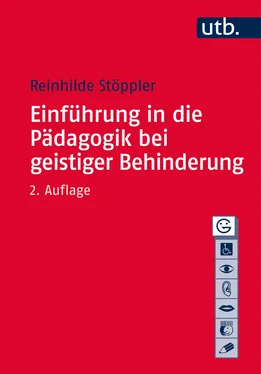Reinhilde Stöppler - Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung
Здесь есть возможность читать онлайн «Reinhilde Stöppler - Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
| Bezeichnung: | Frühkindlicher Autismus |
| „Eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert, eine gestörte Funktionsfähigkeit in den drei psychopathologischen Bereichen der sozialen Interaktion, der Kommunikation und im eingeschränkten repetitiven Verhalten“ (Remschmidt et al. 2012, 21). | |
| Erstmals beschrieben: | Leo Kanner (1943) |
| Häufigkeit: | Jungen sind drei- bis viermal häufiger betroffen als Mädchen. |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: | Früher Beginn; min. sechs Symptome in den drei Bereichen: „qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion“ (z. B. die Unfähigkeit Blickkontakt herzustellen, Gestik, Mimik etc. zur sozialen Interaktion zu verwenden); „qualitative Auffälligkeiten der Kommunikation“ (z. B. die Störung der Entwicklung der gesprochenen Sprache, Echolalie, monotone Sprachmelodie); „begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten“ (z. B. stereotypes Verhalten, ungewöhnliche Interessen, zwanghaftes Bedürfnis nach unveränderter Umwelt)(Remschmidt et al. 2012, 23f.)Unterschieden wird zwischen dem Low-Functioning-Autismus (Personen mit beeinträchtigter Intelligenz und Sprache) und dem High-Functioning-Autismus (keine Intelligenz- und Sprachbeeinträchtigungen). |
| Bezeichnung: | Asperger-Syndrom |
| Erstmals beschrieben: | Hans Asperger (1944) |
| Häufigkeit: | große Variationen, abhängig von den Definitionen11–10.000 (Kamp-Becker & Bolte 2014,26) |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: | keine allgemeine Entwicklungsverzögerung, keine Beeinträchtigung im sprachlichen und kognitiven Bereich; Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion: Besonderheiten der nonverbalen Kommunikation, z. B. deutlich reduziertes bzw. nicht vorhandenes nonverbales Verhalten, kein sozial gerichteter Gesichtsausruck, fehlendes soziales Lächeln, keine konventionellen Gesten;Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzunehmen, zu gemeinsamen Interessen, Aktivitäten und Gefühlen; Mangel an sozioemotionaler Gegenseitigkeit, d. h. keine Wechselseitigkeit in einer Beziehung (z. B. geht der Mensch mit Asperger-Autismus meist nicht auf Gesprächsinhalte und Fragen ein); fehlendes intuitives Verständnis für soziale Regeln; Mangel, spontane Freude, Interessen oder Tätigkeiten mit anderen zu teilen.Auffälligkeiten der Kommunikation, z. B. großer Wortschatz mit originellen Wortschöpfungen, mangelnde „Theory of Mind“; Sonderinteressen an bestimmten Wissensgebieten, z. T. zwanghafte Verhaltensweisen bzgl. des Einhaltens von Routinen und Ritualen |
| Bezeichnung: | Cornelia de Lange-Syndrom |
| Erstmals beschrieben: | Cornelia Catharina de Lange (1933) |
| Häufigkeit: | 1:40.000–100.000 |
| Ätiologie: | unklar |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: | typische Gesichtsmerkmale: zusammengewachsene Augenbrauen; buschige Wimpern; tiefer Haaransatz; Hypertelorismus; Fehlbildungen der Augen; Minderwuchs; Anomalien der Extremitäten;selbstverletzendes Verhalten;autistisch-ähnelnde Verhaltensweisen |
| häufige Erkrankungen: | Infektionen der Atemwege (Neuhäuser 2016, 73ff.) |
| Bezeichnung: | Cri-du-chat-Syndrom (Katzenschrei-Syndrom; aktuelle Bezeichnung: 5p-minus-Syndrom) |
| Erstmals beschrieben: | Jérôme Léjeune (1963) |
| Häufigkeit: | 1:20.000–50.000; Frauen sind häufiger betroffen als Männer |
| Ätiologie: | partielle Deletion 5p15.2 |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: | typische Gesichtsmerkmale: kleines Kinn; tiefsitzende Ohren; Mikrozephalie; vorzeitiges Ergrauen der Haare; niedriges Geburtsgewicht; Verzögerung der motorischen, sprachlichen und geistigen Entwicklung; schrilles (katzenähnliches) Schreien während der Kindheitsphase, auf das die Betroffenen häufig reduziert werden (daher aktuelle Bezeichnung: 5p-minus-Syndrom); aggressives Verhalten |
| häufige Erkrankungen: | Magen-, Darm-, Herz- und Atemprobleme / -infektionen |
| Kompetenzen: | motorische Kompetenzen; lebenspraktische Fähigkeiten; kontaktfreudig; freundlich (Neuhäuser 2016, 168ff.) |
| Bezeichnung: | Down-Syndrom (Trisomie 21) |
| Erstmals beschrieben: | John Langdon Down (1866) |
| Häufigkeit: | 1:600–800 |
| Ätiologie: | Trisomie des Chromosom 21 (Freie Trisomie, Translokationsform, Mosaik-Form) |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: | typische Gesichtsmerkmale: Epikanthus (zusätzliche Lidfalte); schräg nach oben geneigte Lidspalten; kleiner Mund und Kiefer; schmaler Gaumen; Minderwuchs; teils unvollständig entwickelte Handknochen; Sandalenfurche (großer Abstand zwischen dem ersten und zweiten Zeh);Muskelhypotonie (Überdehnbarkeit der Gelenke); verzögerte Sprachentwicklung; sprachliche Auffälligkeiten |
| häufige Erkrankungen: | angeborener Herzfehler; Immunabwehrschwäche; Magen-Darm-Obstruktionen; Sehstörungen (Schielen, Kurz- oder Weitsichtigkeit, Keratokonus, Nystagmus oder Linsentrübungen); Schwerhörigkeit; Hypothyreose; Hepatitis B; Leukämie; Adipositas; Demenz vom Alzheimer Typ (Kap. 8.3) |
| Kompetenzen: | gut ausgebildete pragmatische Kompetenzen; gute soziale Kompetenzen; Erwerb der Schriftsprache; Freude am Imitieren der Bewegungsabläufe; Stärken im visuellen Bereich; frühe Lesekompetenz; musikalische Kompetenzen (Wilken 2014) |
| Bezeichnung: | Fetales Alkohol-Syndrom (Alkoholembryopathie) |
| Erstmals beschrieben: | Jacqueline Rouquette (1957), Paul Lemoine (1968) |
| Häufigkeit: | 1:300–1.000 |
| Ätiologie: | Alkoholembryopathie (durch mütterlichen Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft, Kap. 2.3) |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: | typische Gesichtsmerkmale: kleine Lidspalten; kurze Stupsnase; dünne Oberlippe (mit dünnem, rotem Rand); Mikrozephalie; Gelenkfehlbildungen; kleineres und leichteres Geburtsgewicht; verzögerte motorische, sprachliche und kognitive Entwicklung; Hyperaktivität; Ablenkbarkeit; Aufmerksamkeitsstörungen; Impulsivität und leichte Erregbarkeit sowie Irritierbarkeit bei relativ geringen Anlässen, wie z. B. Kritik |
| häufige Erkrankungen: | Augenerkrankungen (Optikusatrophie / -hypoplasie, Ptosis, Refraktionsanomalien [Myopie, Strabismus]); Mittelohrentzündungen; Störungen des zentralen Nervensystems; angeborener Herzfehler; stark herabgesetztes Schmerzempfinden, sodass die Kinder sehr genau beobachtet werden müssen, um Erkrankungen und Verletzungen zu erkennen |
| Kompetenzen: | soziale Kompetenzen; freundliches Wesen (Stöppler / Wachsmuth 2010, 74f.) |
| Bezeichnung: | Fragiles-X-Syndrom |
| Erstmals beschrieben: | James Purdon Martin, Julia Bell (1943) |
| Häufigkeit: | 1:3.000 – 4.000 |
| Ätiologie: | gonosomale Aberration; Deletion Xq27.3 |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: | typische Gesichtsmerkmale: längliches Gesicht, große Ohren, muskuläre Hypotonie, weiche Haut, hoher Gaumen, Makrozephalie, Kurzsichtigkeit, Mittelohrentzündungen, Störungen der Koordination von Grob- und Feinmotorik; sprachliche Auffälligkeiten: Perseverationen und Echolalie (Wiederholungen); Besonderheiten: autistiforme Kontaktstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen mit und ohne Hyperaktivität (ADHD), epileptische Anfälle (20 %); typische Verhaltensauffälligkeiten: (Hyperaktivität, oppositionelles Verhalten, Wutanfälle, autistische Verhaltensweisen, Blickvermeidung, Handflattern, soziale Ängstlichkeit); Frauen sind häufig weniger stark beeinträchtigt (Richstein 2009; Stöppler / Wachsmuth 2010, 75ff.) |
| Bezeichnung: | Noonan-Syndrom |
| Erstmals beschrieben: | Jacqueline Noonan (1963) |
| Häufigkeit: | 1:1.000 – 2.500 |
| Ätiologie: | X0-Konstitution, autosomal dominant, 12qA |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: | typische Gesichtsmerkmale: große und tiefsitzende Ohren; Hypertelorismus; Minderwuchs; Skelettanomalien; Ess- und Trinkschwächen; Herzfehler; Seh- und Hörbeeinträchtigungen;Muskelhypotonie; verzögerte Pubertät; Hodenhochstand |
| Bezeichnung: | Phenylketonurie |
| Erstmals beschrieben: | Ivar Asbjørn Følling (1934), George Jervis (1953) |
| Häufigkeit: | 1:10.000 |
| Ätiologie: | Störung des Aminosäurestoffwechsels, 12q23, autosomal rezessiv |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung / Verhalten: | blond; blauäugig; fehlende Pigmente; Hautveränderungen;bei Geburt vorhandene Funktionen lassen progressiv nach; psychische Auffälligkeiten (aggressives, zerstörendes Verhalten, Hyperaktivität) |
| häufige Erkrankungen: | Übelkeit und Erbrechen; Krampfanfälle. Bei konsequenter PKU-Diät normale Entwicklung; Frühdiagnose durch Guthrie-Test möglich ( Kap. 2.4) (Achse 2010, 61) |
| Bezeichnung: | Prader-Willi-Syndrom |
| Erstmals beschrieben: | Andrea Prader, Alexis Labhart und Heinrich Willi (1956) |
| Häufigkeit: | 1:10.000 – 25.000 (Männer sind häufiger betroffen) |
| Ätiologie: | Deletion / Translokation 15q11-13 |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung / Verhalten: | typische Gesichtsmerkmale: schmale Stirn, Epikanthus, ophthalmologische Probleme (Strabismus); Kleinwuchs; auffallende Hypotonie (bis etwa zum 2. Lebensjahr); Überstreckbarkeit der Gelenke; schwache Muskeleigenreflexe; Skoliose;verzögerte motorische, sprachliche und kognitive Entwicklung; verzögerte sexuelle Entwicklung (mangelhafte Entwicklung der Geschlechtsorgane [Kryptorchismus bei Jungen]); häufige Unfruchtbarkeit; verzögertes Einsetzen der Pubertät |
| häufige Erkrankungen: | Hyperphagie (ungewöhnlich gesteigerte Nahrungsaufnahme, einsetzend zwischen 1–6 Jahren); Adipositas (unersättlicher Appetit bei gleichzeitig reduziertem Kalorienbedarf, reduziertes / verzögertes Sättigungsgefühl); Bluthochdruck; Herz-Kreislauf-Beschwerden; Atemnot |
| Kompetenzen: | Handlungsintelligenz; visuelle Fähigkeiten; Lesefähigkeit; großer Wortschatz; interessiert (Achse 2010, 112; Hogenboom 2006, 85ff.) |
| Bezeichnung: | Rett-Syndrom |
| Erstmals beschrieben: | Andreas Rett (1966) |
| Häufigkeit: | 1:10.000 –15.000, meist nur Frauen betroffen |
| Ätiologie: | unklar, Xq28-Chromosom |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung / Verhalten: | normale Entwicklung bis zum 18. Lebensmonat, danach Regression sozialer, sprachlicher und adaptiver Funktionen; bereits erreichte Bewegungsfähigkeiten gehen verloren; Störungen der Sensorik und Integration von Wahrnehmungsreizen; Entwicklung motorischer Stereotypien (Waschbewegungen der Hände, Klatschen, Kneten); motorische Ausfälle durch Ataxie und Apraxie des Gehens |
| häufige Erkrankungen: | Anomalien der Atmung (Hyperventilation, Anhalten des Atems); Epilepsie (in 80 % der Fälle); sekundäre Mikrozephalie; etwa zwei Drittel der PatientInnen überleben die ersten zwei Jahrzehnte; Sterblichkeit bei älteren PatientInnen durch Infektionen der Atemwege oder Unfälle beeinflusst; frühe Sterblichkeit hängt vor allem mit schwerer geistiger Behinderung zusammen |
| Kompetenzen: | musikalische Fähigkeiten (Achse 2010, 73) |
| Bezeichnung: | Williams-Beuren-Syndrom |
| Erstmals beschrieben: | J. C. P. Williams und Alois J. Beuren (1961 / 1962) |
| Häufigkeit: | 1:7.500 –15.000 |
| Ätiologie: | Deletion 7q11.23 |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: | längliche Kopfform; Mikrozephalie; kurze Lidspalten; sternförmiges Irismuster; Schielen; flache, schmale Nasenwurzel; Stupsnase; Pausbacken im Kindesalter; großer Mund mit vollen Lippen; meist offener Mund; Zahnanomalien; kleines Kinn und prominente Ohrläppchen; tiefe und raue Stimme; bei blauen Augen oft weißliche, radspeichenartige Einschlüsse der Iris sichtbar; schwere Probleme bei der Nahrungsaufnahme mit Erbrechen und Nierenfunktionsstörungen; Kleinwuchs; Herzfehler und Verengung großer Arterien führen zu Herz-Kreislauf-Problemen; Veränderungen der Gefäße (Nieren, Blase, Magen, Darm); Nierenfunktion nimmt mit zunehmendem Alter ab; häufig Skoliose; Hyperkalzämie; Hypotonie; Beeinträchtigung des Hörvermögens durch häufige Entzündungen;Entwicklungsverzögerungen in den Bereichen Sprache, Motorik und den allgemeinen kognitiven Funktionen; Schwierigkeiten beim Erwerb abstrakter Konzepte, bei visuell-räumlichen Wahrnehmungsaufgaben, mathematischen Fähigkeiten und beim Schreiben; sehr sensibel; freundlich; offen gegenüber fremden Personen bis hin zu Distanzlosigkeit; Überaktivität; Aufmerksamkeitsprobleme; Ängstlichkeit und Geräuschempfindlichkeit |
| Kompetenzen: | geselliger Sprachgebrauch; differenziertes Vokabular und grammatische Kompetenzen, sodass das Gefühl sprachlicher Gewandtheit entsteht; freundlich; musikalische Fähigkeiten; Lesekompetenz (Hyperlexie) (Achse 2010, 51; Hogenboom 2006, 51) |

Die Beschreibung der vier weiteren Syndrome Smith-Lemli- Opitz-Syndrom, Smith-Magenis-Syndrom, Tuberöse Sklerose und Wolf-Hirschhorn-Syndrom sind im Online-Material auf der Seite www.reinhardt-verlag.debzw. utb-shop.de, Ergänzungen zu Kapitel 3.1Syndrome zu finden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.