Aufgrund des Risikos einer Fehlgeburt werden die verschiedenen Untersuchungen der pränatalen Diagnostik z. T. kritisiert und stehen durch ihren möglichen selektierenden Charakter häufig im Fokus der medizinisch-ethischen Diskussion.
„Während sich bei der bisher üblichen vorgeburtlichen Diagnostik auch Befunde mit therapeutischen Konsequenzen ergeben können, erfolgt das Frühscreening ausschließlich mit der Begründung, Ungeborene mit Chromosomenabweichungen herauszufiltern, damit Frauen sich gegebenenfalls für einen Abbruch entscheiden können. Das Angebot des Frühscreenings bestärkt Menschen in der Überzeugung, dass die Geburt eines behinderten Kindes vermeidbar ist und vermieden werden sollte und stellt damit eine kulturelle Abwertung aller Menschen dar, die von Geburt an oder später mit einer Behinderung leben müssen“ (Wegener 2007, 45).
Auch wenn sich komplizierte Eingriffe, die mögliche Folgen und Risiken nach sich ziehen, durch einen nicht-invasiven Test wie z. B. der 2012 neu vorgestellte Bluttest zur Diagnostik von Chromosomenfehlverteilungen unterbinden lassen, bleibt die bereits angesprochene Kritik durch Wegener die gleiche. Der ehemalige Bundes-Behindertenbeauftragte Hüppe reagiert mit ähnlichen Argumenten auf den Bluttest. Eine „Rasterfahndung“ nach Menschen mit Trisomie 21 werde erzeugt, da keine therapeutischen Zwecke verfolgt werden. Durch die unkomplizierte und risikolose Blutentnahme sinke zudem die Hemmschwelle, an einer solchen Untersuchung teilzunehmen (Richter-Kuhlmann 2012, 1).

Neuhäuser, G., Steinhausen, H.-C., Häßler, F., Sarimski, K. (Hrsg.) (2013): Geistige Behinderung: Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte. 4. Aufl. Kohlhammer, Stuttgart
Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wassermann, S. A., Minorsky, P. V., Jackson, R. B. (2016): Campbell Biologie. 10. Aufl. Pearson, Hallbergmoos

Übungsaufgaben zu Kapitel 2
Aufgabe 1
Welche Bedeutung hat die Ätiologie im Kontext der Geistigbehindertenpädagogik?
Aufgabe 2
Wie kommt es zu numerischen und strukturellen Chromosomenaberrationen?
Aufgabe 3
Nennen Sie jeweils Beispiele für Schädigungen, die prä-, peri- und postnatal auftreten können.
3 Erscheinungsformen geistiger Behinderung
3.1 Häufige Syndrome
„Ich habe down-Syndrom
Aber ich stehe da zu
und ich bin kein Alien
denn ich bin so wie ich bin
und jeder soll es verstehen
und mich respektieren“ (Giesler 2002, 69)
Ausdifferenzierung
Durch die Weiterentwicklung der Geistigbehindertenpädagogik aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie nicht zuletzt durch starke Elternvereinigungen konnte viel Wissen über einzelne Syndrome akkumuliert und analysiert werden, sodass die Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung immer differenzierter gesehen wird (Stöppler / Wachsmuth 2010, 72).

Das Wort Syndrom weist darauf hin, dass bei verschiedenen Menschen bestimmte Symptome, Auffälligkeiten oder Krankheitsanzeichen ähnlich oder gleich vorliegen.
In diesem Kapitel erfolgt ein Überblick über Syndrome, die am häufigsten auftreten, d. h., die mindestens 1:100.000 (auf 100.000 Geburten erfolgt eine Geburt mit diesem Syndrom) vorkommen und mit geistiger Behinderung unterschiedlicher Ausprägung einhergehen. In alphabetischer Reihenfolge wird jeweils skizziert, wer als erstes das Syndrom beschrieben hat, die geschätzte Häufigkeit, phänotypische Informationen sowie besondere Kompetenzen und Ressourcen, die in Betreuung und Bildung berücksichtigt werden sollten.
Einzigartigkeit
Die Übersicht erfolgt im Bewusstsein, dass – unabhängig von genetischen Prädispositionen – vielfältige Faktoren auf die Persönlichkeit des betreffenden Menschen einwirken. Der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung ist keine homogene Gruppe von Merkmalsträgern! Jeder hat einzigartige Fähigkeiten und Interessen. Es geht keinesfalls um eine defizit- und symptomzentrierte Beschreibung und Zuschreibungskategorie, sondern vor allem um Ressourcenorientierung. Eine Syndrom-Diagnose kann auch sinnvoll sein, um frühzeitig Kenntnisse über physische und psychische Begleiterkrankungen sowie Therapie- und Fördermaßnahmen zu gewinnen und einzuleiten.
Syndrom-Beschreibungen
Sarimski (2009, 164ff.) zeigt drei wesentliche Aspekte von Syndrom-Beschreibungen auf, nämlich
 Unterstützung der Eltern bei der Entwicklung positiver und realistischer Zukunftsperspektiven,
Unterstützung der Eltern bei der Entwicklung positiver und realistischer Zukunftsperspektiven,
 Entlastung von Schuldgefühlen und
Entlastung von Schuldgefühlen und
 Sensibilisierung für spezifische Bedürfnisse.
Sensibilisierung für spezifische Bedürfnisse.
Phänotyp
Das Verständnis für die besonderen Stärken und Schwächen des Kindes mit geistiger Behinderung können durch das Wissen über das jeweilige Syndrom mit seinen phänotypischen Auswirkungen verstärkt werden (Neuhäuser 2016, 15). Eine frühe Diagnose bietet den Eltern zudem die Möglichkeit, sich der genetischen Risiken bewusst zu werden und die Information bei der weiteren Familienplanung zu berücksichtigen.
Individualität
Jedoch sollte immer verdeutlicht werden, dass es sich bei den Beschreibungen des Phänotyps stets um Wahrscheinlichkeitsmerkmale, nicht um obligate Merkmale und Verhaltensweisen handelt, wobei individuelle Abweichungen immer möglich sind. Das Konzept der Verhaltensphänotypen als Kombination von Entwicklungs- und Verhaltensmerkmalen, die bei einem bestimmten Syndrom wahrscheinlicher sind als bei anderen Syndromen, beschreibt einerseits das Typische eines Syndroms, lässt aber gleichzeitig die Möglichkeit individueller Abweichungen von diesen Typisierungen offen (Flint / Yule 1994; Sarimski 2003).
Variabilität
Innerhalb der benannten Syndrome gibt es eine große Variabilität. Es sollte darauf geachtet werden, dass sowohl die sichtbaren als auch die nicht sichtbaren Phänomene bei jedem Menschen, auch wenn sie mit einem bestimmten Syndrom in Zusammenhang gebracht werden, in sehr unterschiedlicher Anzahl, Ausprägung und Wirkung vorhanden sind. In jedem Fall steht der Mensch in seiner Einzigartigkeit und nicht das Syndrom im Vordergrund.
Im weiteren Verlauf erfolgt eine Übersicht ausgewählter Syndrome.
Tab. 7: Übersicht bekannter Syndrome geistiger Behinderung
| Bezeichnung: |
Angelman-Syndrom |
| Erstmals beschrieben: |
Harry Angelman (1965) |
| Häufigkeit: |
1:20.000 |
| Ätiologie: |
Deletion mütterliches 15q11-13 |
| Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten: |
Mikrozephalie (zu kleiner Schädel mit vermindertem Umfang); abgeflachtes Hinterhaupt; eingezogenes Mittelgesicht; tiefliegende Augen; relativ breiter Mund mit oft vorgestreckter Zunge; Zahnfehlstellungen; kräftiger Unterkiefer mit spitzem Kinn; Hypopigmentierung (verminderte Pigmentierung der Haut); Krampfanfälle; verzögerte motorische Entwicklung; Ataxie (Störung der Bewegungskoordination mit unkontrollierten Bewegungen); beeinträchtigte sprachliche Entwicklung; häufig unpassendes Gelächter |
| häufige Erkrankungen: |
Infektionen der Atemwege; Mittelohrentzündungen; Übergewicht; abnormes EEG |
| Kompetenzen: |
sehr freundlich; gute visuelle Wahrnehmungsleistungen; gutes Gedächtnis (Neuhäuser 2016, 49ff.; Hogenboom 2006, 95ff.) |
| Bezeichnung: |
Autismus-Spektrum-StörungenTiefgreifende Entwicklungsstörungen (ICD-10), werden in mehrere Untergruppen eingeteilt:- frühkindlicher Autismus- atypischer Autismus- Rett-Syndrom- desintegrative Störungen des Kindesalters- überaktive Störungen mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien- Asperger-Syndrom- sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen |
| Ätiologie: |
multikausal:- genetische Einflüsse- komorbide Störungen- Hirnfunktionsstörungen- kognitive und neuropsychologische Symptome- emotionale sowie Störungen der Theory of Mind / Empathie (Remschmidt / Kamp-Becker 2006, 34). |
Im Folgenden werden die zwei häufigsten / bekanntesten Formen von Autismus skizziert.
Читать дальше
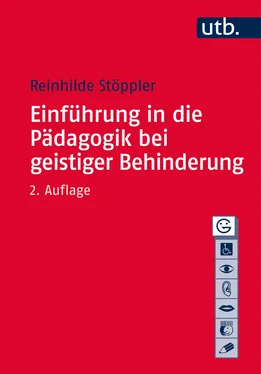



 Unterstützung der Eltern bei der Entwicklung positiver und realistischer Zukunftsperspektiven,
Unterstützung der Eltern bei der Entwicklung positiver und realistischer Zukunftsperspektiven,










