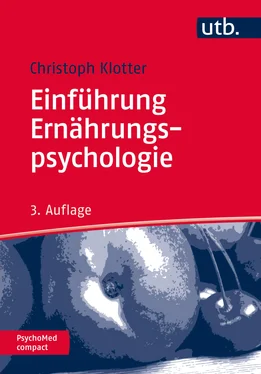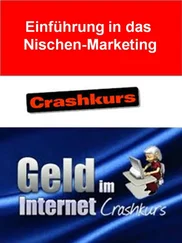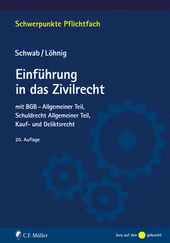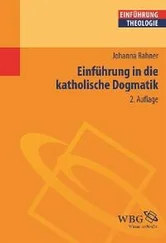Auch der Streit am Mittagstisch, ob eine Fleischbeigabe überhaupt notwendig ist, hat historische Wurzeln. Am Mittagstisch treffen so die „barbarische“ Tradition (möglichst viel Fleisch essen) mit dem römisch-christlichen Erbe eventuell konflikthaft aufeinander. Ebenfalls kulturell überformt ist die Lebensmittelpräferenz. In unseren Breitengraden essen wir nicht gerne Heuschrecken, und wir verspeisen auch keine süßen kleinen Katzen.
Dass Lebensmittel nicht nur Mittel zum Zweck sind, um zu überleben, belegt die Nutzung von Speisen, um sich von anderen zu unterscheiden. Nahrungsaufnahme ist ein Mittel der sozialen Distinktion. Die Geschichte lehrt, dass Essen oder bestimmte Lebensmittel häufig dafür eingesetzt wurden, um Macht und Reichtum zu demonstrieren. Auch heute noch lässt sich am Verzehr bestimmter Lebensmittel der soziale Status ablesen. Mit finanziellen Mitteln aus Harz IV lassen sich Hummer und Trüffel schwerlich bezahlen.
Nicht einmal Essstörungen sind frei von historischen und kulturellen Einflüssen. In einer bestimmten Kultur zu einer bestimmten Zeit gilt Wohlbeleibtheit als Ausdruck von Macht und Ansehen. In einer anderen Kultur in anderen Zeiten ist sie als Krankheit etikettiert und verpönt.
Im Alltagsbewusstsein ist es nicht deutlich verankert, wie stark soziale Faktoren die Gesundheit und die Nahrungsaufnahme beeinflussen. Wer eine gute Ausbildung, ein gutes finanzielles Auskommen und einen interessanten Beruf hat, ist deutlich gesünder und lebt länger. Die Kluft zwischen arm und reich wird derzeit nicht kleiner, sondern größer. Die Qualität der Herkunftsfamilie und der elterliche Erziehungsstil spielen eine beträchtliche Rolle bei der Herausbildung von gesunder oder ungesunder Ernährungsweise. Was und wie gegessen wird, ist nicht nur individuelle Wahl oder reiner Zufall. Vielmehr repräsentieren und konstruieren die Art der Nahrungsaufnahme und die Küche eine soziale Ordnung.
1.11 Fragen zum ersten Kapitel
Überprüfen Sie Ihr Wissen!

1. Welche historischen Traditionen bestimmen die heutige Nahrungsaufnahme?
2. Welche Theorien bietet die Soziologie an, um Lebensmittelpräferenzen zu erklären?
3. Was bedeutet der Begriff der sozialen Distinktion?
4. Wie beeinflusst die Sozialisation das Essverhalten?
5. Wie werden die Definition und die Verbreitung von Essstörungen durch gesellschaftliche Einflüsse mitbestimmt?
2 Psyche, Soma und die Nahrungsaufnahme
Psychosomatik vs. Medizin
Die Frage: „Wie beeinflusst die Psyche die Nahrungsaufnahme“ wird nicht erst heute gestellt. Diese Frage rührt aus der Tradition der Psychosomatik, die Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden ist. Die als Gegenbewegung zur ausschließlich naturwissenschaftlichen Medizin konzipierte Psychosomatik bremste einerseits also eine Entwicklung, die Krankheit auf körperliche Prozesse reduzieren wollte. Sie lief und läuft andererseits Gefahr, in einen Pan-Psychologismus zu verfallen. Das meint, dass der Versuch unternommen wird, alle körperlichen Prozesse, so auch Krankheiten, auf die Psyche zurückzuführen.
bio-psycho-sozial
Der einfachen Frage nach dem Einfluss der Psyche auf den Körper wurde im 20. Jahrhundert die Frage hinzugefügt: Wie wirkt der Körper auf die Seele? Bezogen auf die Nahrungsaufnahme, bedeutet dies: Wie wirkt sich die Nahrungsaufnahme auf die Psyche aus? Die psychosomatische und die somatopsychische Fragestellung wurden anschließend in das umfassende bio-psycho-soziale Gesundheits- und Krankheitsmodell integriert. Umfassend bedeutet hier, dass die sozialen Dimensionen von Gesundheit und Krankheit mit einbezogen werden. In den letzten Jahrzehnten hat sich neben der Psychosomatik die Verhaltensmedizin etabliert. Diese basiert auf dem bio-psycho-sozialen Modell, bearbeitet ähnliche Fragestellungen wie die Psychosomatik. Sie grenzt sich aber von der Psychosomatik ab, da sie nicht psychoanalytisch, sondern verhaltenstherapeutisch orientiert ist.
2.1 Die klassische Psychosomatik
Als sich im 19. Jahrhundert allmählich die naturwissenschaftliche Medizin durchsetzte, etablierte sich parallel dazu die Psychosomatik – als Gegenbewegung zur naturwissenschaftlichen Medizin. Gelang es der naturwissenschaftlichen Medizin immer besser, zahlreiche Erkrankungen als rein biologische Prozesse zu erforschen, so setzte sich die Psychosomatik davon ab, indem sie postulierte, dass körperliche Erkrankungen nicht nur durch körperliche Faktoren verursacht seien. Vielmehr könnten psychische Konflikte zu körperlichen Erkrankungen führen.

Der Terminus „Psychosomatik“ setzt sich aus zwei griechischen Begriffen zusammen: „Psyche“ ist die Seele und „Soma“ ist der Körper. Die klassische Psychosomatik geht von einem unilinearen Prozess aus: Aus seelischen Konflikten entstehen körperliche Symptome. Sie untersuchte nicht den umgekehrten Zusammenhang, dass nämlich auch aus körperlichen Erkrankungen psychische Probleme entstehen können. Oder allgemeiner noch, dass Psyche und Körper in komplexer Wechselwirkung zueinander stehen.
Freud und die Hysterie
Die Geschichte der Psychosomatik ist untrennbar mit dem Begründer der Psychoanalyse verbunden, mit Sigmund Freud. Er entwickelte die erste bedeutsame psychosomatische Theorie. Nachdem er viele Jahre lang naturwissenschaftlich gearbeitet hatte, konfrontierte er sich mit einer „Modeerkrankung“ des 19. Jahrhunderts: der Hysterie. Diese erschien ihm nicht naturwissenschaftlich erforschbar zu sein. Im Rahmen eines psychotherapeutischen Gesprächs versuchte er, die seelischen Ursachen der Hysterie zu erkunden. Psychologische Laborexperimente dienen dazu, Ursache-Wirkungs-Gefüge, also allgemeine natur wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, die alle Menschen betreffen, zu ergründen. Das psychotherapeutische Gespräch diente Freud dagegen dazu, die individuell spezifischen unbewussten Ursachen der Hysterie bewusst zu machen und zur Sprache zu bringen.

Der noch relativ junge Freud macht einen Ausflug in die Hohen Tauern, „um für eine Weile die Medizin und besonders die Neurosen zu vergessen.“ (Freud 1999a, 184) Dies sollte ihm nicht gelingen. Eine junge Frau, Katharina, bittet um seine Hilfe, da sie „nervenkrank“ sei. Nervenkrank bedeutet für sie Atemnot, Druck auf den Augen, ein schwerer und sausender Kopf, Schwindel, zusammengepresste Brust und zusammengepresster Hals, verbunden mit Todesangst. Katharina hat keine Ahnung, warum sie ihrer Meinung nach nervenkrank ist. In einem relativ kurzen Gespräch gelingt es den beiden, die unbewussten Motive der Nervenkrankheit bewusst zu machen. Eines davon ist der massive Ekel angesichts der versuchten sexuellen Übergriffe ihres Vaters. Aber warum hat Katharina diesen Ekel verdrängt? Eine Antwort könnte sein, dass ihr der Gedanke, dass ihr Vater ihr gegenüber sexuell übergriffig werden wollte, unerträglich war. Sie musste diesen Gedanken und die damit verbundenen Gefühle abwehren. Anstelle dieser Gefühle und Gedanken entstanden körperliche Beschwerden. Katharina war es sozusagen lieber, körperlich zu leiden, als mit unerträglichen Gefühlen und Gedanken konfrontiert zu sein.
Freud ging davon aus, dass der hysterischen Symptomatik entweder wie bei Katharina sexuelle Traumata oder unakzeptable Liebesregungen zugrunde liegen. In der Zeit Freuds war es z. B. für ein Hausmädchen moralisch unakzeptabel, sich in den Hausherrn zu verlieben. Da wir heute andere Moralvorstellungen haben, würde dieses Hausmädchen heutzutage vermutlich keine körperliche Symptomatik entwickeln.
Читать дальше