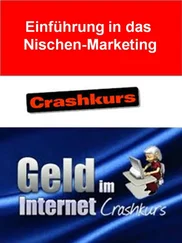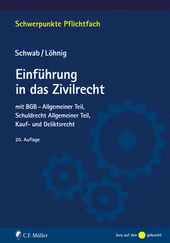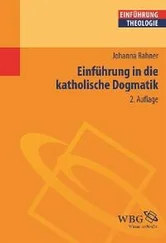Erziehungsstil
Die Befunde von Hays et al. (2001) und Patrick et al. (2005) lassen sich dahingehend bündeln, dass weder Gleichgültigkeit noch autoritärer Erziehungsstil zu gesundem Ernährungsverhalten der Kinder führen. Vielmehr scheinen sich Kinder dann gesund zu ernähren, wenn sie ein entschlossenes Anliegen der Eltern spüren, ohne sich allerdings diesem Anliegen blind unterwerfen zu müssen. Entscheidend ist auch, dass gesunde Ernährung nicht zum Dogma erhoben wird.

Weitere Studien zum Zusammenhang von Sozialisation und Ernährungsverhalten belegen Folgendes:
 Roos et al. (2001) konnten einen starken Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau in Haushalten und dem Konsum von rohem Gemüse ermitteln: Je höher das Bildungsniveau, umso höher war auch der Konsum von rohem Gemüse. Die Schulleistungen hatten ebenfalls einen starken Einfluss auf diesen Konsum. Wer gute Schulleistungen hatte, aß viel Gemüse.
Roos et al. (2001) konnten einen starken Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau in Haushalten und dem Konsum von rohem Gemüse ermitteln: Je höher das Bildungsniveau, umso höher war auch der Konsum von rohem Gemüse. Die Schulleistungen hatten ebenfalls einen starken Einfluss auf diesen Konsum. Wer gute Schulleistungen hatte, aß viel Gemüse.
 In einer Längsschnittstudie untersuchten Lake et al. (2004), wie sich Personen ihr verändertes Essverhalten im Zeitraum von der Jugend bis zum Erwachsenenalter erklären. Die Veränderungen wurden zugeschrieben dem Einfluss der Eltern, des Partners, der Kinder, dem Ernährungsbewusstsein, der Beschäftigung und dem Mangel an Zeit. Der Einfluss der Eltern wurde sowohl als positiver als auch als negativer, dem man entkommen muss, erlebt. Für Männer, die eine Partnerschaft eingingen, war der Einfluss der Partnerin auf das Essen tendenziell ein positiver.
In einer Längsschnittstudie untersuchten Lake et al. (2004), wie sich Personen ihr verändertes Essverhalten im Zeitraum von der Jugend bis zum Erwachsenenalter erklären. Die Veränderungen wurden zugeschrieben dem Einfluss der Eltern, des Partners, der Kinder, dem Ernährungsbewusstsein, der Beschäftigung und dem Mangel an Zeit. Der Einfluss der Eltern wurde sowohl als positiver als auch als negativer, dem man entkommen muss, erlebt. Für Männer, die eine Partnerschaft eingingen, war der Einfluss der Partnerin auf das Essen tendenziell ein positiver.
 Hannon et al. (2003) ermittelten, dass die Person, die in einem Haushalt das Essen zubereitet, sehr großen Einfluss auf das Essverhalten des Ehepartners und der Kinder hat. Nimmt diese Person viel Gemüse und Obst zu sich, so tun dies auch der Partner und die Kinder. Isst diese Person viel Fett, so essen auch Partner und Kinder viel Fett. Verstärkt wird dieser Einfluss, wenn viele Mahlzeiten gemeinsam eingenommen werden.
Hannon et al. (2003) ermittelten, dass die Person, die in einem Haushalt das Essen zubereitet, sehr großen Einfluss auf das Essverhalten des Ehepartners und der Kinder hat. Nimmt diese Person viel Gemüse und Obst zu sich, so tun dies auch der Partner und die Kinder. Isst diese Person viel Fett, so essen auch Partner und Kinder viel Fett. Verstärkt wird dieser Einfluss, wenn viele Mahlzeiten gemeinsam eingenommen werden.
 Nicklaus et al. (2005) schreiben der Kindheit einen wesentlichen Einfluss auf das spätere Essverhalten zu. In einer prospektiven Studie verfolgten sie die Entwicklung kleiner Kinder bis in das junge Erwachsenenalter. Wer als zwei- bis dreijähriges Kind eine freie Auswahl von Lebensmitteln treffen durfte, ernährte sich als Jugendlicher oder als junger Erwachsener abwechslungsreich und damit gesund.
Nicklaus et al. (2005) schreiben der Kindheit einen wesentlichen Einfluss auf das spätere Essverhalten zu. In einer prospektiven Studie verfolgten sie die Entwicklung kleiner Kinder bis in das junge Erwachsenenalter. Wer als zwei- bis dreijähriges Kind eine freie Auswahl von Lebensmitteln treffen durfte, ernährte sich als Jugendlicher oder als junger Erwachsener abwechslungsreich und damit gesund.
1.9 Soziologische Modelle der Ernährung
Eigensinn der Disziplinen
Es liegt in der Eigenart vermutlich jeglicher wissenschaftlicher Disziplin, einen bestimmten Forschungsgegenstand für die eigene Disziplin zu reklamieren. Für die Medizin oder die Oecotrophologie ist die Nahrungsaufnahme überwiegend ein körperlicher Vorgang. Die Psychologie möchte geltend machen, dass psychische Variablen eine entscheidende Rolle spielen können. Die Soziologie will die sozialen Dimensionen der Ernährung herausstellen. Sie wendet sich gegen Modelle, die entweder soziale Merkmale gar nicht berücksichtigen oder – wie das von ihr angeprangerte biokulturelle Modell – die sozialen und kulturellen Aspekte der Ernährung nur als Verlängerung oder soziale Transformation körperlicher Vorgänge begreifen (Barlösius 2011). Würde z. B. in allen menschlichen Kulturen morgens, mittags und abends nur Kuchen gegessen werden, dann würden die Vertreter des biokulturellen Modells behaupten, dass der Körper des Menschen mit ausschließlichem Kuchenkonsum ernährungsphysiologisch am besten versorgt sei.

Barlösius (2011; u. a. im Anschluss an Eder 1988, 103ff) unterscheidet unter Ausschließung des biokulturellen Ansatzes folgende soziologische Modelle. Alle versuchen zu erklären, warum in bestimmten Gesellschaften Nahrungstabus bestehen:
 Das rationalistische Modell: Repräsentant hierfür ist Harris (1988). Harris geht davon aus, dass sich für jedes Nahrungstabu rationale Gründe finden lassen: Tabus garantieren das nutritive Überleben einer Gemeinschaft oder Gesellschaft.
Das rationalistische Modell: Repräsentant hierfür ist Harris (1988). Harris geht davon aus, dass sich für jedes Nahrungstabu rationale Gründe finden lassen: Tabus garantieren das nutritive Überleben einer Gemeinschaft oder Gesellschaft.
 Diesem Ansatz gegenüber steht das funktionalistische Modell, das Nahrungstabus auf die Stabilisierung einer bestehenden Ordnung zurückführt. Mit Nahrungstabus stärkt eine Gesellschaft ihre eigene Identität und grenzt sich von anderen Gesellschaften ab. Das funktionalistische Modell geht also davon aus, dass Tabus auf mehr fußen als nur auf einer rationalen Ökonomie. Tabus können eine Gesellschaft zusammenhalten.
Diesem Ansatz gegenüber steht das funktionalistische Modell, das Nahrungstabus auf die Stabilisierung einer bestehenden Ordnung zurückführt. Mit Nahrungstabus stärkt eine Gesellschaft ihre eigene Identität und grenzt sich von anderen Gesellschaften ab. Das funktionalistische Modell geht also davon aus, dass Tabus auf mehr fußen als nur auf einer rationalen Ökonomie. Tabus können eine Gesellschaft zusammenhalten.
 Das strukturalistische Modell setzt die Kultur vor die Natur. Denn die Natur muss zuerst symbolisch konstituiert werden, um sie begreifen zu können. Die Natur erschließt sich entsprechend dieses Modells nicht unmittelbar. Sie bedarf der Sprache, um zugänglich zu werden. Eine dieser Sprachen ist die Küche. Die Küche dient nach Lévi-Strauss (1976) zusätzlich dazu, die menschlichen Grundkategorien Natur und Kultur zu vermitteln. Der strukturalistische Ansatz untersucht außerdem die Küche, um herauszufinden, welche kognitive Ordnung eine Gesellschaft sich gibt. Der Strukturalismus sucht wie ein Detektiv in der Küche die Logik einer Gemeinschaft.
Das strukturalistische Modell setzt die Kultur vor die Natur. Denn die Natur muss zuerst symbolisch konstituiert werden, um sie begreifen zu können. Die Natur erschließt sich entsprechend dieses Modells nicht unmittelbar. Sie bedarf der Sprache, um zugänglich zu werden. Eine dieser Sprachen ist die Küche. Die Küche dient nach Lévi-Strauss (1976) zusätzlich dazu, die menschlichen Grundkategorien Natur und Kultur zu vermitteln. Der strukturalistische Ansatz untersucht außerdem die Küche, um herauszufinden, welche kognitive Ordnung eine Gesellschaft sich gibt. Der Strukturalismus sucht wie ein Detektiv in der Küche die Logik einer Gemeinschaft.
 Das Modell des Paradoxes der doppelten Zugehörigkeit: Der Mensch als Allesesser kann sich frei entscheiden, was er essen will. Das ist seine kulturelle Freiheit. Tiere könnten hingegen in der Regel nicht frei entscheiden, was sie essen wollen. Ihnen geben die Instinkte vor, was sie an Nahrung zu sich nehmen können. Menschen in ihrer kulturellen Freiheit könnten allerdings die Natur nicht vergessen. Würde sich ein Mensch nur von Kuchen ernähren, was seine Freiheit beinhaltet, würde er sich massiv mangelernähren. Die Natur fordert also ihre Rechte. Deshalb befindet sich der Mensch im Widerspruch oder Paradox zwischen Freiheit und Zwang.
Das Modell des Paradoxes der doppelten Zugehörigkeit: Der Mensch als Allesesser kann sich frei entscheiden, was er essen will. Das ist seine kulturelle Freiheit. Tiere könnten hingegen in der Regel nicht frei entscheiden, was sie essen wollen. Ihnen geben die Instinkte vor, was sie an Nahrung zu sich nehmen können. Menschen in ihrer kulturellen Freiheit könnten allerdings die Natur nicht vergessen. Würde sich ein Mensch nur von Kuchen ernähren, was seine Freiheit beinhaltet, würde er sich massiv mangelernähren. Die Natur fordert also ihre Rechte. Deshalb befindet sich der Mensch im Widerspruch oder Paradox zwischen Freiheit und Zwang.
unterschiedliche Interpretationen
Die von Barlösius angebotenen soziologischen Modelle der Ernährung widersprechen sich offenkundig. Es ist zu vermuten, dass die Diskussion nicht mit der Aussage beendet werden kann: Das eine Modell ist richtig, das andere Modell ist falsch. Vielmehr bleiben sie Interpretationsfolien oder Perspektiven, die je nach konkretem Forschungsgegenstand brauchbarer oder unbrauchbarer sind. Möglicherweise lassen sie sich auch parallel gebrauchen: Wenn die Kuh in Indien nicht geschlachtet werden darf, so mag dies im Sinne von Harris rationale Gründe haben, dieses Tabu kann im Sinne des funktionalistischen Modells auch identitätsstiftend sein.
1.10 Zusammenfassung des ersten Kapitels
Nicht nur physiologische Prozesse regulieren die Nahrungsaufnahme. Es reicht aber auch nicht aus, den physiologischen Steuerungen nur psychische Variablen hinzuzufügen. Vielmehr beeinflussen gesellschaftlich-kulturelle und soziale Faktoren das Essverhalten erheblich. Dies sollte in diesem Kapitel veranschaulicht werden. Gesellschaftlich-kulturelle und soziale Determinanten des Essverhaltens sind dem Bewusstsein wenig zugänglich, da sie wie selbstverständlich existieren. So muss erst gründlich reflektiert werden, dass die derzeitige Versorgung mit Lebensmitteln in Anbetracht der Menschheitsgeschichte einem Paradies gleichkommt.
Читать дальше
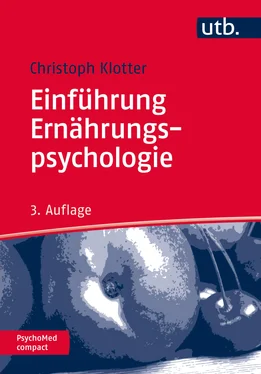

 Roos et al. (2001) konnten einen starken Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau in Haushalten und dem Konsum von rohem Gemüse ermitteln: Je höher das Bildungsniveau, umso höher war auch der Konsum von rohem Gemüse. Die Schulleistungen hatten ebenfalls einen starken Einfluss auf diesen Konsum. Wer gute Schulleistungen hatte, aß viel Gemüse.
Roos et al. (2001) konnten einen starken Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau in Haushalten und dem Konsum von rohem Gemüse ermitteln: Je höher das Bildungsniveau, umso höher war auch der Konsum von rohem Gemüse. Die Schulleistungen hatten ebenfalls einen starken Einfluss auf diesen Konsum. Wer gute Schulleistungen hatte, aß viel Gemüse.