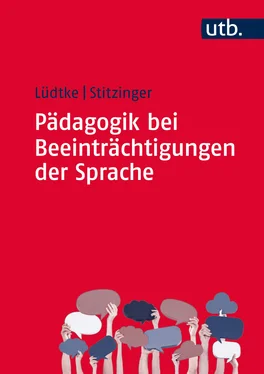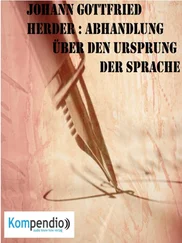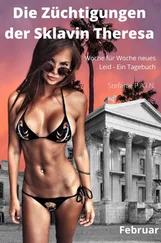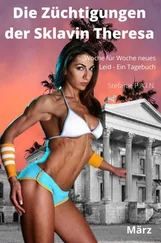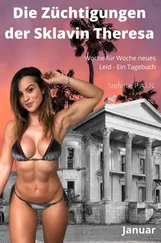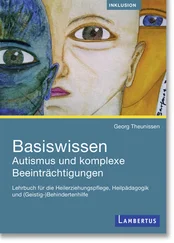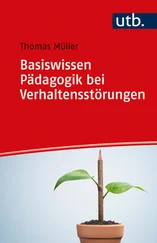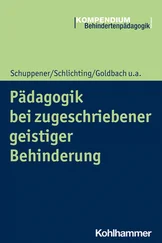Raum für Rekonstruktion beschädigter Sprachlichkeit
Oberste pädagogische Prämisse zur Verhinderung von Identitätsbeschädigungen bei Menschen mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen muss deshalb die Integration sprachlicher Identität sein Raum für eine Rekonstruktion desintegrierter Sprachlichkeit kann von sprachpädagogisch und sprachtherapeutisch tätigen Personen auf drei verschiedenen Wegen ermöglicht werden. Erstens können der sprachlich-kommunikativ beeinträchtigten Person identitätsrekonstruierende Lösungswege über das Erleben der eigenen sprachlichen Kompetenz vermittelt werden, indem z.B. die sprachlich-kommunikativ beeinträchtigte Person einer anderen Person ein Rätsel stellt und sich damit in einer kompetenten, überlegenen Position befindet Zweitens kann sich in Förderung, Unterricht, Therapie oder Beratung statt an einem sprachwissenschaftlich bestimmten normativen Bildungsziel der linguistischen Homogenität zukünftig an einem sprachpädagogisch bestimmten autonomen Bildungsziel der Differenzanerkennung orientiert werden (Lüdtke 2004a, 2004b), indem z.B. eine sprachlich-kommunikativ beeinträchtigte Person bei der Planung des individuellen Förderziels selbst einbezogen wird. Und drittens sollte eine permanente Reflexion möglicher identitätsbeschädigender Akte der sprachpädagogischen bzw. sprachtherapeutischen Fachkraft selbst erfolgen, indem z.B. die Fachkraft das eigene Sprachhandeln und davon ausgelöste Wirkungen wahrnimmt und überprüft (Abb. 11).
Am Fallbeispiel 2 Anna (Kap. 1)wird nachfolgend die Integration sprachlicher Identität durch Akzeptanz der Erstsprache verdeutlicht
Anna, die zu Hause mit ihrer Familie Russisch spricht, sucht sich in der Kindertagesstätte Spielkameradinnen, die ebenfalls Russisch sprechen. Dieser Kontakt und diese Kommunikationsmöglichkeit bedeuten für sie eine Sicherheit im Prozess des täglichen Ankommens, stellt aber auch eine wichtige Basis dar, um sich generell in der neuen zweisprachigen Umgebung zurechtzufinden. Anna fällt der Schritt in die neue Sprache und die veränderten Kommunikationsformen aus einer gefestigten Position heraus leichter. Sie bildet somit allmählich eine zweisprachige Identität aus. Würde man den Kindern verbieten, in der Kindertagesstätte Russisch zu sprechen, dann müsste Anna ihre Erstsprache Russisch sozusagen an der Eingangstür „ablegen". Sie führe dann nur einen Teil ihrer Identität mit. Die Kita mit ihrer wertschätzenden bilingualen Kommunikationskultur sowie der Gebrauch verschiedenster Erstsprachen durch pädagogische Fachkräfte mit Migrationshintergrund unterstützen die sprachpädagogische Prämisse der Integration sprachlicher Identität.
Gesellschaft: Inklusion sprachlicher Heterogenität
Partizipation durch sprachliche Normentsprechung
Die zweite Dimension, durch die sich das Verhältnis Person-Sprache bestimmt, ist die Gesellschaft (Lüdtke 2012a). Maßgeblicher konstitutiver Faktor sind dabei ihre jeweiligen sprachlichen Normen, welche unter den Aspekten ihrer Aufstellung, ihres Austausches und ihrer Vermittlung makro- wie mikrosystemisch in Soziolinguistik und Soziosemiotik (soziologische Teildisziplinen der Sprach- und Zeichenwissenschaften) sowie der Sprachsoziologie konzeptualisiert werden.
In einer soziolinguistischen Perspektive ist beispielsweise relevant, dass sprachliche Normen als Teil übergreifender sozialer Normen Konsens einer bestimmten Sprachgemeinschaft sind (Jaspers 2012). Für die Person, und damit auch sämtliche Menschen mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen in der gesamten Lebensspanne, bedeutet dies, dass für die gesellschaftliche Partizipation eine sprachliche Normentsprechung Voraussetzung ist (Abb. 11).
Marginalisierung sprachlicher Defizite
In einem solchen normativen System können Personen, die aufgrund ihrer sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen abweichende, nonkonforme sprachliche Äußerungen oder kommunikative Akte produzieren, wegen ihrer sprachlichen „Defizite" marginalisiert (Abb. 11), d.h. an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Im gesellschaftlich geprägten Bildungs- und Gesundheitssystem kann dies im Rahmen sprachdiagnostischer Prozesse geschehen. Die Klassifizierung bzw. Etikettierung von identifizierten Sprachentwicklungsverzögerungen hat beispielsweise für Schülerinnen und Schüler personale Relevanz, da sie ein präskriptives Normenverständnis impliziert. Die durch Spracherwerbstests festgestellte sprachliche Standardabweichung wird somit als Defizit, als Makel bzw. als schlecht attribuiert. Es kann damit zu einem Attribut werden, das seinem Träger als subjekt-inhärentes Merkmal zugeschrieben wird und sein Person-Sein wie seine Sprachlichkeit defizitär definiert: „der Sprachbehinderte“, „der Stotterer“, „die Schülerin mit Förderbedarf“ (Kap. 1).
Anerkennung sprachlicher Differenz und Einzigartigkeit
Aus pädagogischer Perspektive ist immer zu bedenken, dass die Einführung von vermeintlich objektiven Wertmaßstäben wie der gesellschaftlichen Sprachnorm immer Auswirkungen auf die ganze Person und ihre Sprachlichkeit hat, welche die subjektive Verkörperung des analysierten linguistischen Sachverhaltes, beispielsweise einer Aussprachestörung, ist. Um personale Beschädigungen innerhalb des Bildungsprozesses zu vermeiden, ist eine erste pädagogische Prämisse, Menschen mit Beeinträchtigungen der Sprache und Kommunikation nicht über die Identifikation sprachlich-kommunikativer Defizite – und dazu gehört beispielsweise ein sprachlicher Förder- und Unterstützungsbedarf von Schülerinnen und Schülern – zu stigmatisieren und zu marginalisieren. Vielmehr ist dafür Sorge zu tragen, ihre Einzigartigkeit als sprachliche Differenz anzuerkennen. Damit können sich sprachpädagogische und sprachtherapeutische Fachkräfte auch des utilitaristischen Grundgedankens der sozialen Verwertbarkeit von Sprache entledigen, der letztlich eine Missachtung der Person und ihrer Sprachlichkeit per se darstellt. Diese paradigmatische Wendung vom Defizit- zum Differenzbegriff (Kap. 1)ist Voraussetzung für die wahre Inklusion sprachlicher Heterogenität von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf (Kap. 8). (Abb. 11).
Am Fallbeispiel 4 Claudia (Kap. 1)wird nachfolgend die Inklusion sprachlicher Heterogenität durch institutionelle Anerkennung sprachlicher Differenz verdeutlicht

Im Gymnasium steht Claudia nicht abseits, im Gegenteil, sie steht manchmal sogar im Mittelpunkt des Geschehens. Aufgrund des Sprachcomputers, den sie mit den Augen steuert, vermag sie ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen. Sicherlich bedeutet diese Form der Kommunikation eine hohe Akzeptanz vonseiten der Mitschüler und Mitschülerinnen. Das war nicht von Anfang an der Fall. Als Claudia den Computer noch nicht perfekt bedienen konnte und die Gesamtsituation für die Schule neu war, gab es deutliche Annäherungsschwierigkeiten. Nach außen hin versuchten zwar die meisten Schülerinnen und Schüler, offen auf Claudia zuzugehen, aber tatsächlich stand sie oft allein am Rand. Echte Freundschaften entwickelten sich erst viel später. Die von den Lehrerinnen und Lehrern vielfältig konkretisierte sprachpädagogische Prämisse der Inklusion sprachlicher Heterogenität brauchte die institutionelle und gesellschaftliche Anerkennung sprachlicher Differenz und viel Zeit.
Kultur: Ermöglichung von Bildungsteilhabe
Menschwerdung: Sprachbesitz als Schwelle zur Kultur
Letzter wichtiger Punkt für eine Bestimmung der Sprachlichkeit des Menschen ist, dass anthropologisch der Sprachbesitz als Schwelle zur Kultur angesehen wird. Kulturbesitz markiert damit die semiotische Schwelle zwischen der Welt der Zeichen und der Welt der Kultur auf der einen Seite, und der nicht-zeichenhaften, kulturlosen Welt beispielsweise der Tiere auf der anderen Seite. Der Besitz der Sprache ermöglicht deshalb nicht nur die kulturelle Teilhabe, sondern ist sogar Bedingung der Menschwerdung und des Mensch-Seins (Abb. 11).
Читать дальше