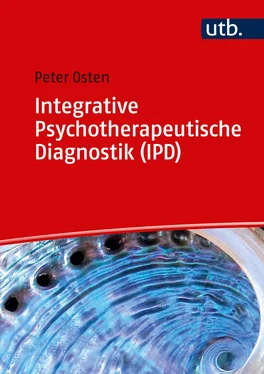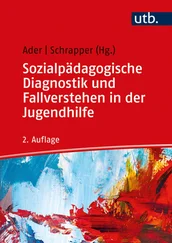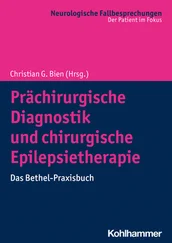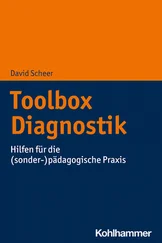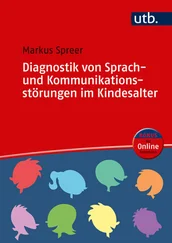3.3 Multiaxiale Klassifikation nach ICD, DSM und ICF
Achse I: Klinisches Bild| Achse II: Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörungen| Achse III: Körperliche Störungen und Behinderungen| Achse IV: Psychosoziale Probleme und Belastungsfaktoren| Achse V: Allgemeines Niveau der sozialen Anpassung| Komorbidität von Sucht- und Abhängigkeitsstörungen
3.4 Psychodynamische Diagnostik nach OPD
4 Praxis der ätiologischen Diagnostik
4.1 Akutsymptomatik und klinische Phänomenologie
4.2 Beginn und Auslöser
4.3 Verlauf, Phasen und Prozess
4.4 Akute Komorbidität
4.5 Longitudinale Akkumulation
4.6 Attribution und subjektive Krankheitstheorie
4.7 Abwehr, Funktion und Bewältigung
4.8 Einschränkungen im Lebensvollzug und Leidensdruck
5 Persönlichkeit, Ressourcen, Potentiale, Resilienz
5.1 Heuristik zur healthy functioning personality
5.2 Dimensionen der Ressourcen, Potentiale und Resilienzanalyse
5.3 Diagnostik der Persönlichkeitsstörungen
6 Die Behandlungsplanung
VI Die Integrative Psychotherapeutische Diagnose
1 Struktureller Aufbau
2 Exemplarische Durchführung
VII Schlusswort
VIII Register
1 Endnoten
2 Literatur
3 Sachwortregister
Hinweis:
Im UTB-Shop finden Sie auf der Unterseite zum Buch digitales Zusatzmaterial: http://www.utb-shop.de/integrative-psychotherapeutische-diagnostik-ipd-10122.html
Psychotherapeutische Diagnostik steht am Beginn jeder Behandlung und hat hier eine vielschichtige Aufgabe zu erfüllen. Ihr geht es nicht nur um die klassifikatorische Feststellung von Störungsbildern, sondern vor allem darum, ein Bild von beidem zu erhalten – der Entstehung von Dysfunktionalität sowie der Genese von Resilienz, Kompetenzen und Potenzialen des Menschen. In biografisch aufdeckenden und supportiven Verfahren ist hierfür eine Sichtung der gesamten Lebensspanne des Menschen notwendig, aus der auch prognostische Perspektiven für die Entwicklung der Persönlichkeit, mit ihren Strukturen, Narrativen und ihrer Dynamik, erkennbar werden. Darüber hinaus will psychotherapeutische Diagnostik auch jene Fakten zur Kenntnis bringen, die den mentalen Repräsentationen und Bedeutungssystemen der Person entstammen und wichtige Behandlungsvoraussetzungen darstellen, etwa das Krankheitserleben, subjektive Krankheits-, Gesundheits- und Veränderungstheorien, Merkmale der Beziehungsgestaltung, projektive Tendenzen sowie Affiliations- und Übertragungsbereitschaften.
Das Verfahren der Integrativen Therapie versteht sich als eine Form problem-, ressourcen- und potenzialorientierter „Humantherapie“, die über eine Zentrierung auf die Pathologie des Subjekts hinausgeht, eine salutogenetische Orientierung und ökologische Perspektive mit in den Blick nimmt. Sie sieht Menschen gendersensibel im Gesamt ihrer Leiblichkeit, eingebettet in soziale und ökologische Kontexte (embodied and embedded) – sich permanent in Entwicklung und Wandlung befindend in den Prozessen ihres biografischen und zeitgeschichtlichen Kontinuums. In diesem Geschehen wird die vitale Angewiesenheit auf eine integrierte Sozialität und auf eine unbeschädigte Ökologie unübersehbar. Dieses Überschreiten tradierter Formen der Individuumszentrierung zieht veränderte Strategien der Wahrnehmung, der kognitiven Einschätzung und emotionalen Bewertung psychischer und ökopsychosomatischer Funktionalität und Dysfunktionalität nach sich, die in der initialen Diagnostik, aber natürlich auch im Therapieverlauf, in der prozessualen Diagnostik, somit auch in der Behandlung immer ihren Niederschlag finden.
Die Förderung von Gesundheit, Kreativität und Sinnverstehen beginnt dort, wo Dysfunktionalität nicht allein von ihrer Leidensseite her, sondern gleichzeitig als Herausforderung an die Aktivierung eigener Ressourcen, Resilienzen und Potenziale betrachtet wird. In jeder Biografie sind Geschichten von Gesundheit und Krankheit eng ineinander verflochtene Stränge des Entwicklungsgeschehens. Heilung bedeutet nicht nur Wiederherstellung beschädigter Gesundheit, sondern auch Wachstum an persönlicher Souveränität und Lebenskunst. In der Folge überwundener Krisen finden sich immer wieder auch Akzentverschiebungen in subjektiven Werten und Orientierungen, das Leben, das persönliche Selbst- und Weltbild betreffend. Forschungen zum Posttraumatic Growth geben deutliche Hinweise hierauf.
Die Theorien zur Genese von positiver und dysfunktionaler Persönlichkeitsentwicklung werden in der Integrativen Therapie unter eine klinische entwicklungs-, gesundheits- und persönlichkeitspsychologische Perspektive in longitudinaler Orientierung gestellt und finden hier ihre empirische Fundierung. Darüber hinaus werden aber auch humanwissenschaftliche Ansätze „multipler Entfremdung und Verdinglichung“ herangezogen, um die soziale, gesellschaftliche und ökologische Seite menschlicher Störungsanfälligkeit herauszustellen. Um die Positionen eines solchen Menschen- und Weltbildes wissenschaftlich abzustützen, wurden Ansätze einer klinischen Philosophie entwickelt, unter deren Dach sich empirische Vorgehensweisen phänomenologisch-hermeneutisch, leibphilosophisch, anthropologisch, sozialphilosophisch und mundanologisch verbinden lassen.
Der Autor, langjährig psychotherapeutisch in Psychiatrie und Psychotherapie erfahren und tätig, seit 25 Jahren auch als Lehrtherapeut für Integrative Therapie, hat diesen von Hilarion G. Petzold, Johanna Sieper, Ilse Orth und Hildegund Heinl (†) entwickelten Ansatz einer schulenübergreifenden Humantherapie in kenntnisreicher Weise dargestellt und mit gelungenen Methoden- und Praxiskonzepten umgesetzt. Wir möchten an dieser Stelle unserer Freude Ausdruck verleihen, dass das innovative Verfahren damit nützliche, eigenständige Beiträge zum Fundus einer modernen klinisch-psychologischen und psychotherapeutischen Diagnostik leisten kann, die dem gesamten Feld zugutekommen können. Wir wünschen dem Buch viel Erfolg und hoffen, dass seine Konzepte über die Grenzen des Verfahrens hinaus in vielen gesundheitsrelevanten Bereichen Interesse finden und zur Anwendung kommen werden.
| Mai 2019 |
Claudia Höfner, Wien Anton Leitner, St. Pölten Ilse Orth, Hückeswagen/Erkrath Hilarion G. Petzold, Hückeswagen/Erkrath |
Dieses Buch trägt einen langen Anlauf in sich. Als ich zu Beginn der 1990er Jahre in der universitären Akutpsychiatrie meine psychotherapeutische und beraterische Tätigkeit aufnahm, war ich fasziniert von der Komplexität der psychiatrischen Diagnostik, dem Engagement und der Präzision, mit der meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen diese versuchten umzusetzen. Bereits einige Jahre zuvor hatte ich die „Integrative Therapie“ kennengelernt, in der der Mensch, die Person mit ihrer Lebensgeschichte und Transgenerationalität, ihrer kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität im Zentrum stand. Damals erschienen mir die wissenschaftlichen Communitys zwischen querschnittlich-pathologiezentrierter und longitudinal-salutogeneseorientierter Diagnostik noch strikt getrennt, ihre inbegriffenen Theorien und Ideologien unvereinbar. Während für meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen über der Bestimmung von Psychopathologie Mensch, Person und Biografie in den Hintergrund traten, lehnten die Kollegen und Kolleginnen meines Verfahrens aus Gründen des ,Labeling‘ eine fest- oder zuschreibende Diagnostik weitgehend ab. Dieser Spannungsbogen, in dem ich 13 Jahre arbeitete, inspirierte mich, nach Verbindungen zwischen meinem Verfahren und der nach meinem Verständnis so notwendigen psychiatrischen Diagnostik zu suchen.
Читать дальше