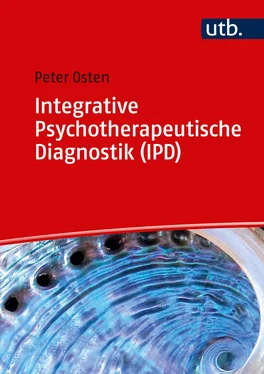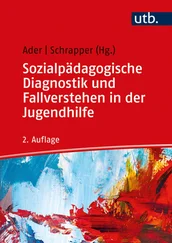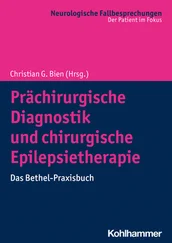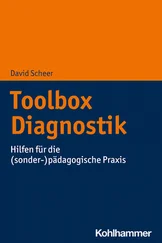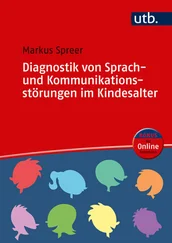Paradoxerweise sind es gerade die Humanwissenschaften, die systematisch Erkenntnisse über den Menschen und sein Verhalten in der Gesellschaft sammeln, die dann wiederum als Kontroll- und Herrschaftswissen zur Disziplinierung von Individuen, bis hinein in deren Leiblichkeit, verwendet werden (Foucault, 1987 [1976]). So stellen sie ein Programm zur Reglementierung und Gleichschaltung sozialer Prozesse dar. Das Soziale verliert hier das Orientierende und wird zur Verstörung (Baudrillard, 1978, 2010b). Wenn Menschen das selbsttätige, souveräne, an Lebensklugheit (Luckner, 2005) orientierte Denken aufgeben, opfern sie ihre Wirklichkeit hegemonialen Machtdiskursen. Marcus Steinweg (2015) hat das zynisch den „Pseudosubstanzialismus der Tatsachenesoteriker“ genannt.
Obwohl Geisteswissenschaften large scale theories darstellen, bringen sie doch nicht weniger zeitepochale Denkströmungen zum Ausdruck, als dies empirische Wissenschaften tun. Sie sind kulturell, ethnisch, gesellschaftlich und religiös imprägniert, von den Werten, Orientierungen und Sinnattraktoren ihrer Zeit durchsetzt, in unserer Zeit auch politisch und wirtschaftlich „engagiert“ – im doppelten Wortsinn (Gadamer, 1960; Bühler, Ekstein & Simkin, 1998). Man denke hierbei an Fragen der Ethik, die neuzeitlich von Wirtschaft, Politik und Wissenschaften an die Philosophie herangetragen werden, in denen sie bloß noch die Rolle einer „Magd der Notwendigkeiten“ spielt (Badiou, 2015a, 47f.; Fuchs et al., 2010).
Unsere Philosophie ist eurozentrisch, mittelschichtspezifisch und tendenziell an den Geschlechterstereotypien orientiert. Sie hat stets versucht, den „Armen Möglichkeiten und Muße des Denkens zu nehmen, um das Privileg der Philosophie vor der unheilvollen Vermischung mit Zwitterwesen und Bastarden zu bewahren“ (Rancière, 2010). Sie ist daher weder vor Ideologisierungen noch vor Mythenbildungen geschützt und ihren Nutzern, wie die Psychotherapie eine ist, wird hiermit eine dekonstruktivistische Haltung ihren Entwürfen gegenüber angeraten (Petzold & Sieper, 2014; Williams, 2011).
Erkenntnisinteressen von Psychotherapeutinnen richten sich auf die intersubjektive Erfassung von Bedeutungen in den Lebensläufen ihrer Patienten. Lebensgeschichte aber wird subjektiv erinnert und in Begegnungen erzählt (Schacter, 1996; Röttgers, 1992; Bläser, 2015). Psychotherapeutische Einsicht ist daher durch das Maß sozialkonstruktivistischer Erkenntnismöglichkeiten limitiert. Das ist nicht etwa wenig, impliziert aber einen Verzicht auf Objektivierung. Erlebte, erinnerte und erzählte Wirklichkeit ist immer individuelle und soziale Konstruktion, sie ist narrativ, das heißt, nie faktizistisch deutbar (Bläser, 2015). Im Erzählen selbst erfüllt sie die naturwüchsige Funktion, dass die sich erinnernde und erzählende Person in einem Zuge ihre Identität narrativ ,neu erfindet‘ und zusammen mit dem Zuhörer eine entsprechende sequenzielle Wirklichkeit erschafft, eine Wirklichkeit, auf die man sich bezieht, weil sie im intersubjektiven Raum unmittelbarer emotioneller und kognitiver Bezogenheit ko-kreativ erschaffen wurde (Berger & Luckmann, 1969; von Tiling, 2008; Röttgers, 1992).
Dabei spielen die Sprache und das Sprechen nicht die einzige, aber eine zentrale Rolle (Petzold, 2010f.). Hinsichtlich dessen wäre es naiv zu glauben, dass sie bloß dazu da seien, Gedanken, Gefühle oder Bedeutungen zum Ausdruck zu bringen, denn gleichzeitig konstruieren wir im Geflecht ihrer Strukturen und Verwerfungen unser Sein (Jullien, 2010; Krämer, 2001; vgl. Krappmann, 2005). Wie das erlebt wird und wie das intersubjektiv (zurück-)wirkt, hängt ganz vom Erleben und den Attributionen der beteiligten Subjekte ab (Försterling & Stiensmeier-Pelster, 1994). Subjektive Vorstellungen, ihre Bedeutung und ihre Wirkungen auf das Erleben und Handeln sind aus der positivistischen Außenperspektive der Naturwissenschaften schlichtweg nicht erfassbar (Putnam, 1998; Searle, 1991).
Die spezialisierten Gebiete der Natur- und Sozialwissenschaften untersuchen stets nur partialisierte Phänomene (Kühn & Petzold, 1992). Die kürzlich von den Neurowissenschaften aufgeworfene Infragestellung des freien Willens und weitere hegemoniale Deutungsansprüche dieser Teildisziplin zeigte dies überdeutlich (Libet, Freeman & Sutherland, 1999; Libet, 2005; Singer, 2004; Roth, 2003). Der Wille als Epiphänomen neurophysiologischer Vorgänge: Mereologische (Verhältnis vom Teil zum Ganzen), perzeptiologische und deterministische Fehlschlüsse der Hirnforschung konnten schnell nachgewiesen werden (hierzu: Pothast, 2016; Janich, 2009; Pauen, 2004; Bieri, 2003; Schuch, 2012). Das Hirn ist weder die „Seele“ noch der Mensch, schon gar nicht die Person, und es ist auch nicht das handlungssteuernde Organ. Die ehrgeizigen Neurowissenschaften denken, den Menschen allein in biologischen Begrifffen erklären zu können. „Darwinitis und Neuromanie“ (Tallis, 2016) minimieren die Unterschiede zu unseren nächstverwandten Tieren, leugnen die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen und verhindern damit ein klares Denken darüber, wer wir sind und, vor allem, wer wir sein könnten (ebd., 16).
Die Inanspruchnahme wissenschaftlich „geliehenen Wissens“ kann zu Zwecken der Manipulation und Fremdentmündigung angestellt werden, etwa um mit solchem „Faktenobskurantismus“ (Steinweg, 2015) persönliche Interessen in Einzelne, Gruppen oder die Gesellschaft hinein zu kolportieren. Jede Theorie muss an der Erfahrung scheitern können, nur so können sich Erkenntnisprozesse weiterentwickeln (Popper, 1971). In jedem Fall zeigt sich „starkes Denken“ (Arnold, 2018) darin, dass es Alterität, Pluralität und Diskursivität zulassen kann, somit den „Abschied vom Prinzipiellen“ (Marquard, 1986a) vollzogen hat.
Ob aus korrelativen Zusammenhängen und Signifikanzergebnissen in einem Organ des Köpers die Deutung der Unfreiheit des Menschen als Ganzes zulässig ist, dafür sind Metaüberlegungen, der Einbezug anderer Teilwissenschaften erforderlich. In Deutung und Übertragung ihrer Geltungsansprüche sowie in ihren Anwendungen sollten naturwissenschaftliche Erkenntnisse daher plurale hermeneutische Diskurse durchlaufen (Petzold, 1994a). Dies bringt die Aufgabe mit sich, die multiparadigmatische Vielfalt von Begrifflichkeiten aus Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften unter das Dach von „Integratoren“ zu bringen, wie dies im integrativen Ansatz geschehen ist (Petzold, 1993). Es ist traditionell die Aufgabe der Philosophie, in Einzelbefunde zersplittertes Wissen wieder zu kontextualisieren und sie unter das eine Dach des menschlich Wahrnehmbaren zusammenzuführen (vgl. Petzold & Sieper, 2008; Fuchs, 2012; Höffe, 2015).
2 Humanwissenschaftlicher Hintergrund
Mit dieser Hinführung beginnt die Darstellung derjenigen geistes- und humanwissenschaftlichen Ansätze, die eine klinische Relevanz für das Thema der Integrativen Psychotherapeutischen Diagnostik ausweisen. Obligate Lebensthemen, die den Menschen und seine Lebensgestaltung betreffen, wurden ausgewählt und in aller Kürze essayistisch ausgeführt. Sie sollen in dieser Art der Darstellung nicht nur informieren, sondern vor allem zu eigener Auseinandersetzung anregen. Es werden zum Teil starke Positionen bezogen, mit denen man ringen, ja streiten sollte. Erst so erschließt sich der Sinn der Texte. Bei allem steht eine pragmatische Ausrichtung der Philosophie im Vordergrund (Kant, Böhme), die der klinischen Praxis den Vorrang vor der Auseinandersetzung vergleichender theoretischer und metatheoretischer Reflexion gibt. Bestehende Verhältnisse werden nicht einfach nur beschrieben, sondern kritisch beleuchtet und mit einer Tendenz zu transversalen Entwicklungen dargestellt (Petzold, Sieper & Orth, 2013b). Hauptintention dieser Ausführungen „Klinischer Philosophie“ (Petzold, 2003) ist, ein Bewusstsein für ein weiträumiges Menschenbild zu schaffen, das Individuumszentrierung und Solipsismus überschreitet, mit entsprechenden Orientierungen die Haltung der Therapeutin betreffend. So kann jedes der behandelten Themen als diagnostische und klinische Kategorie angesehen werden, die sich auch interventiv nutzen lässt.
Читать дальше