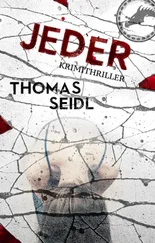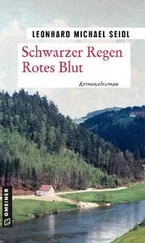Bedeutung für die Therapie
Bedeutung für die Therapie 
Die Therapie sollte sich also nicht nur nach der klinischen Symptomatik richten, sondern auch nach der Krankheitsursache. Bei den exogenen Krankheiten liegt das auf der Hand: wenn das Gehirn geschädigt ist, muss ich somatisch behandeln oder zumindest versuchen, eine Verschlechterung der körperlichen Situation zu verhindern. Eine therapeutische Intervention kann durchaus auf symptomatischer Ebene ansetzen, etwa medikamentös, oder es kann der Versuch unternommen werden, die Krankheitserscheinungen und ihre Folgen psychotherapeutisch abzufangen. Dies geschieht jedoch im Wissen, dass ich mit diesen Maßnahmen das Übel sozusagen nicht an der Wurzel packen kann. In jedem Falle also hat meine Ursachenzuschreibung therapeutische Konsequenzen. Wenn ich von einer körperlichen Ursache ausgehe, werde ich auch eher körperlich behandeln. (Heutzutage vor allem durch Medikamente, Neurostimulation oder andere biologische Verfahren.) Wenn ich dagegen krankmachende äußere Einflussfaktoren annehme versuche ich möglicherweise präventiv, diese auszuschalten. (In einer radikalen Form wurde dies im Zuge der Antipsychiatrie-Bewegung in den 1970er Jahren gelebt, als unter der Annahme, dass psychischen Krankheiten Folge der gesellschaftlichen Verhältnisse seien, eine schulmedizinische Therapie abgelehnt und stattdessen mit den Patienten eine Mischung aus alternativer Lebensform und politischer Agitation praktiziert wurde.) Wenn ich dagegen feststelle, dass Leid auf innerpsychischen Prozessen beruht, werde ich versuchen, diese psychotherapeutisch zu klären und zu lösen. Zwar strebt eine moderne Sicht nach einer Überwindung dieser Einseitigkeit, und die Gabe von Medikamenten schließt natürlich keine Psychotherapie aus. Eine therapeutische Schwerpunktsetzung ist im Einzelfall dennoch sinnvoll.
 Gegenseitige Beeinflussung von Soma und Psyche
Gegenseitige Beeinflussung von Soma und Psyche 
Heutzutage erscheint eine strenge Ursachenzuschreibung auf den ersten Blick überholt, da wir gewohnt sind, von multifaktoriellen Geschehnissen auszugehen und Wechselwirkungen zwischen Soma und Psyche annehmen, bei denen sich Ursache und Wirkung nicht klar trennen lassen (etwa wenn psychische Faktoren dazu führen, dass unser neuronales Netz moduliert wird, was wiederum auf die Psyche zurückwirkt). Wo wir hier angreifen, erscheint beliebig: dies kann dann sowohl auf neurobiologischer Ebene stattfinden (etwa durch Medikamente oder Modulation mittels Stimulationsverfahren) als auch durch psychotherapeutische Einflussnahme – letztlich beeinflusst sich alles gegenseitig, der Ansatzpunkt wäre demgemäß nicht wesentlich und die Wirkung vergleichbar. Studien mit bildgebenden Verfahren scheinen dies zu belegen, wenn sie zeigen, dass sowohl Psychotherapie als auch medikamentöse Therapie die Funktion neuronaler Kreisläufe bei Patienten mit depressiver Episode modifiziert, wenn auch in verschiedenen zerebralen Bereichen (Boccia et al. 2016). Dennoch ist es wichtig, sich immer wieder über mögliche Ursachen Gedanken zu machen. Der klinische Alltag zeigt, dass in aller Regel eine Zuordnung durchaus möglich ist. Der Umstand, dass dies nicht bei allen Patienten mühelos gelingt, darf jedenfalls nicht dazu führen, auf jede Ursachenzuschreibung generell zu verzichten. Wenn ein Patient unter einer Erkrankung leidet, die nach allem, was wir heute wissen, auf dem Boden einer biologischen Verletzlichkeit entstanden ist und bei der der vorsichtige Einsatz bestimmter Medikamente nachgewiesenermaßen hilfreich ist, dann ist es verkehrt, diesem Patienten ausschließlich Psychotherapie anzubieten. Wenn ein anderer Patient dagegen unter einer Symptomatik leidet, deren Auflösung Umlernen und Veränderungen erfordern würden, dann können Medikamente keine Psychotherapie ersetzen, sondern bestenfalls auf Symptomebene eine kurzfristige Erleichterung bringen.
Eine Brücke zwischen den Grundlagen psychischer Krankheit und den daraus folgenden klinischen Erscheinungen schlägt die anthropologisch-phänomenologische Psychiatrie, indem sie sich auf das innere Erleben des Patienten fokussiert. Sie geht dabei über das rein formale Beschreiben von Symptomen hinaus und bemüht sich um ein tieferes Verständnis des Erlebens der eigenen Person und der Welt in Gesundheit und Krankheit. Dabei wird eine ganzheitliche Sicht angestrebt, die dem Menschen in seiner Subjektivität, seinen Verhältnissen und Bedingtheiten einschließlich somatischen Aspekten bis hin zu neurobiologischen Grundlagen gerecht wird. Die phänomenologische Anamnese ist entsprechend bemüht, die Selbst- und Weltsicht des Patienten zu begreifen (Fuchs 2016). Sie strebt nach der hermeneutischen Erarbeitung von Sinnstrukturen, die das Erleben und Handeln leiten (Schmidt-Degenhard 1997).
Die anthropologisch-phänomenologische Psychiatrie beschränkt sich freilich nicht auf das reine Erfassen und Beschreiben von Zuständen, sondern bildet hieraus Hypothesen zu Krankheitsentstehung und Symptomentwicklung, die schließlich auch in therapeutische Überlegungen münden. Dennoch sieht sich die Phänomenologie immer wieder dem Vorwurf der Praxisferne ausgesetzt. Bedacht werden muss auch, dass ein Verständnis der Selbst- und Weltsicht des Patienten in der Psychose an ihre Grenzen stößt, wenn besondere Gesetzmäßigkeiten und die eigene Qualität des Erlebens ein Begreifen und Verstehen im üblichen Sinne nicht ohne weiteres gestatten (  Kap. 1.3).
Kap. 1.3).
Die Geschichte ist voll von unterschiedlichsten Sichten auf psychiatrische Krankheiten, von streng ordnenden diagnostischen Systemen bis hin zur völligen Ablehnung jeglicher Diagnose in der Antipsychiatrie-Bewegung und ihren Ausläufern seit den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts. Um ein Verständnis für die aktuelle Einordnung psychiatrischer Krankheiten zu bekommen, ist es sinnvoll, sich mit der Historie der Sichtweisen und den daraus resultierenden Systemen der Klassifikation zu beschäftigen. Im Folgenden soll deshalb ein kleiner Einblick in historische Entwicklungen der psychiatrischen Nosologie gegeben werden. Der rote Faden ist dabei die immer wieder gestellte Frage nach Krankheitsursachen, deren jeweilige Antwort die Klassifikationen maßgeblich geprägt hat und weiterhin prägt.
 Ordnungssysteme im 18. Jahrhundert
Ordnungssysteme im 18. Jahrhundert 
Die Entwicklung eines zusammenhängenden diagnostischen Systems psychiatrischer Krankheiten beginnt im 18. Jahrhundert mit der Entwicklung der ordnenden, deskriptiven Naturwissenschaften. In seinem System der Krankheiten »Genera morborum« klassifiziert Carl von Linné (1707–1778) nach seinem System der Pflanzen im Jahr 1742 in einem Kapitel auch die psychischen Störungen. Die 1772 erscheinende »Synopsis nosologiae methodicae« von William Cullen (1710–1790) enthält ebenfalls eine Systematik der Geisteskrankheiten (Überblick in Dilling 1999). Cullen ist es auch, der den Begriff Neurose einführt, zunächst noch als Ausdruck für die nichtentzündlichen Erkrankungen des Nervensystems (  Kap. 1.4).
Kap. 1.4).
Читать дальше

 Bedeutung für die Therapie
Bedeutung für die Therapie 
 Kap. 1.3).
Kap. 1.3).