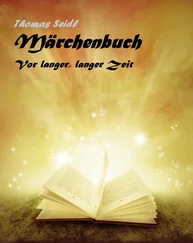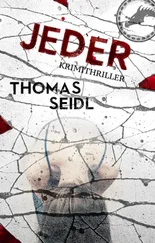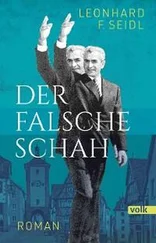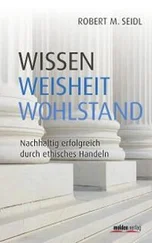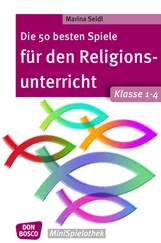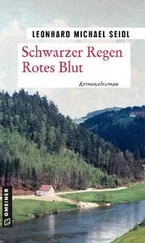Psychoanalytische Auffassung
Psychoanalytische Auffassung 
Die Auffassung einer psychogenen Grundlage von Neurosen bezieht sich auf Aspekte der kindlichen Entwicklung. Das neurotische Verhalten kann als Anpassungsleistung verstanden werden, die zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung für den Betroffenen durchaus nützlich war, im späteren Leben jedoch unpassend und dysfunktional in Erscheinung tritt. Im psychoanalytischen Verständnis liegen den Neurosen demgemäß (unbewusste) kindliche Konflikte oder Erschütterungen zugrunde, die zunächst eine kompromisshafte Lösung erfahren, später jedoch störend in Erscheinung treten können. Ihrem Ursprung nach sind sie weiterhin in gewisser Weise sinnhaft, da sie einen innerpsychischen Lösungsversuch darstellen. Der sonst in diesem Zusammenhang gebräuchliche Trauma-Begriff wird hier bewusst vermieden, da dieser um der Klarheit willen für Situationen außergewöhnlicher Bedrohung reserviert bleiben und nicht inflationär gebraucht werden sollte.
 Neurosenlehre und Psychosen
Neurosenlehre und Psychosen 
Die Ausdehnung der Neurosenlehre auf Psychosen greift zu weit und wird der komplexen Ätiologie von Psychosen, die auch organische Faktoren umfasst, nicht gerecht. Schon Sigmund Freud (1856–1939) musste erkennen, dass die psychoanalytische Herangehensweise bei psychotischen Patienten nicht zielführend ist, und hat sich entsprechend auf die Behandlung nicht-psychotischer Patienten konzentriert und ausgehend von diesen seine Theorien entwickelt. Eine unkritische Anwendung psychoanalytischer Modelle auf Psychosen einschließlich psychotischer Unterformen affektiver Störungen ist deshalb nicht sinnvoll.
 Charakterneurose
Charakterneurose 
Der Begriff Charakterneurose bezieht sich auf die Annahme, dass die Persönlichkeit durch neurotische Mechanismen in ihrer Entwicklung derart gestört und dadurch verformt wurde, dass dies zur Persönlichkeitsstörung geführt hat. Eine derartige Bezeichnung muss freilich als sehr theorielastig gelten. Sie impliziert, dass die Persönlichkeitsentwicklung nicht von multiplen Faktoren (Genetik, Umwelt, Erziehung, Beziehungserfahrungen etc.), sondern vor allem durch dysfunktionale (neurotische) Konfliktlösungen geprägt wurde. Da diese Sicht sehr einseitig ist, sollte der Begriff zugunsten beschreibender Ansätze in der Persönlichkeitsdiagnostik ( 
Kap. 4.8.1
) vermieden werden.
 Verwendung des Neurose-Begriffs
Verwendung des Neurose-Begriffs 
Der Begriff Neurose ist in der Alltagssprache etabliert und wird regelmäßig mit bestimmten Begriffen in Zusammenhang gebracht, was gelegentlich zur Verwirrung führt. Dies lässt sich gut anhand der »Zwangsneurose« illustrieren, eines Ausdrucks, der von Sigmund Freud geprägt wurde und allgemein mit Zwangsstörungen assoziiert wird. Freud führt unter anderem im klassischen Fallbeispiel vom »Rattenmann« die Zwangsgedanken eines Patienten ursächlich auf dessen kindliche sexuelle Wünsche in Verbindung mit der Furcht vor negativen Konsequenzen zurück. Nicht zuletzt durch die Theorien Freuds (und nicht nur unter medizinischen Laien) hält sich die klischeehafte Ansicht, dass Zwänge prinzipiell neurotisch seien, also ihre Ursache in frühen Konflikten haben, die es aufzulösen gilt. Tatsächlich jedoch sind Zwangsphänomene vielgestaltig und können unterschiedliche, auch organische, Ursachen haben. Die Behandlung erfolgt dementsprechend heutzutage nicht primär psychoanalytisch, sondern verhaltenstherapeutisch, gegebenenfalls unterstützt durch eine medikamentöse Therapie. Von einer Neurose sollte also nur dann noch gesprochen werden, wenn damit explizit auf das zugrunde liegende Störungsmodell Bezug genommen wird. Entsprechend ist nicht nur der Begriff Zwangsneurose allgemein durch Zwangsstörung ersetzt worden. Weitgehend obsolet geworden sind auch Begriffe wie Konversionsneurose (heute: dissoziative Störung) oder Angstneurose (heute: Angststörung).
Warum ist es sinnvoll, sich in der Psychiatrie mit der Ursache von Krankheiten zu beschäftigen? Würde es nicht genügen, wenn wir die Symptome in Querschnitt und Längsschnitt betrachten und daraus eine Diagnose ableiten? Ist es überhaupt möglich, klare Ursachen zu bestimmen? Und kann sich die Therapie am Ende nicht ganz einfach nach den Symptomen richten?
 Gründe für die Beschäftigung mit Krankheitsursachen
Gründe für die Beschäftigung mit Krankheitsursachen 
Für die Beschäftigung mit Krankheitsursachen gibt es mehrere Gründe. Erstens ist es für ein grundlegendes Verständnis psychiatrischer Erkrankungen wichtig, sich prinzipiell damit auseinanderzusetzen, wie diese entstehen können. Ich beginne den Unterricht deshalb gerne mit diesem Thema, um den Einstieg in die komplexe Welt der Psychiatrie zu erleichtern. Zweitens verlangt die diagnostische Zuordnung im Rahmen der gängigen Klassifikationssysteme sehr wohl ätiologische Überlegungen. Und drittens beeinflusst eine Hypothese über Krankheitsursachen im Allgemeinen oder im speziellen Falle eines Patienten in wesentlichem Maße das therapeutische Vorgehen. Natürlich lässt sich nicht in allen Fällen eine eindeutige Ursache bestimmen, aber das sollte uns nicht davon abhalten, uns auf die Suche zu begeben. Auf diese Punkte wird im Folgenden etwas genauer eingegangen.
 Dualismus von Soma und Psyche
Dualismus von Soma und Psyche 
Beginnen wir mit den grundlegenden Möglichkeiten, wie psychiatrischen Krankheiten entstehen können. Entsprechend dem Dualismus von Soma und Psyche zieht sich durch die Geschichte der Medizin die Überlegung, ob eine psychische Krankheit nun körperliche oder innerpsychische Ursachen hat (  Kap. 1.6). Selbst wenn äußere Einflüsse als zusätzlicher, außerhalb der Person liegender Faktor eingezogen werden, kann doch unterschieden werden, ob diese sich auf den Körper (z. B. Rauschmittel, Umweltgifte) oder auf die Psyche (z. B. soziale Konflikte, gesellschaftliche Rahmenbedingungen) auswirken. Auch wenn wir davon ausgehen, dass Soma und Psyche hinsichtlich Ursache und Wirkung untrennbar miteinander verbunden sind und sich wechselnd gegenseitig beeinflussen, bleibt doch die Frage nach dem Ausgangspunkt einer Krankheit.
Kap. 1.6). Selbst wenn äußere Einflüsse als zusätzlicher, außerhalb der Person liegender Faktor eingezogen werden, kann doch unterschieden werden, ob diese sich auf den Körper (z. B. Rauschmittel, Umweltgifte) oder auf die Psyche (z. B. soziale Konflikte, gesellschaftliche Rahmenbedingungen) auswirken. Auch wenn wir davon ausgehen, dass Soma und Psyche hinsichtlich Ursache und Wirkung untrennbar miteinander verbunden sind und sich wechselnd gegenseitig beeinflussen, bleibt doch die Frage nach dem Ausgangspunkt einer Krankheit.
 Ursache und klinische Symptomatik
Ursache und klinische Symptomatik 
Читать дальше
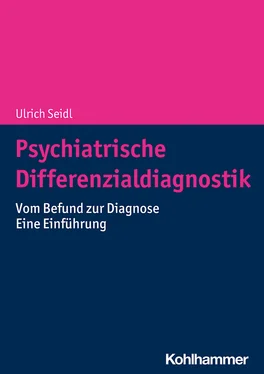
 Psychoanalytische Auffassung
Psychoanalytische Auffassung